Neuropsychologische Störungen bei coronavirusassoziierten Erkrankungen
Erscheinungsbild, Diagnostik und Rehabilitation
Abstract
Zusammenfassung. Nach Infektionen mit Coronaviren (z. B. SARS-CoV-2; COVID-19; ICD-10 [International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems]: U07) und assoziierten Begleit- und Folgeerkrankungen berichten Betroffene häufig über kognitive, emotionale und motivationale Beeinträchtigungen. Das Erscheinungsbild ist komplex und inkludiert Symptome wie verminderte Belastbarkeit, Müdigkeit, Aufmerksamkeits- und Gedächtnisbeeinträchtigungen sowie dysexekutive Störungen. Fortbestehende Funktionsstörungen werden den Beschwerdebildern eines „Long-/Post-COVID“-Syndroms zugerechnet. Nach einer Übersicht relevanter biomedizinischer Informationen werden die neuropsychologischen Störungen mit pathogenetischen Mechanismen und klinischen Syndromen in Beziehung gesetzt und Implikationen für die neuropsychologische Diagnostik und Therapie abgeleitet. Im Kontext der Rehabilitation des „Neuro-COVID“ leistet die Neuropsychologie nicht nur wichtige Beiträge zur Definition von Effektkriterien, sondern trägt auch dazu bei, spezifische Behandlungsbedürfnisse für Untergruppen von Betroffenen zu ermitteln, Krankheitsverläufe und Behandlungsergebnisse vorherzusagen sowie Entscheidungshilfen für die Behandlungsplanung bereitzustellen.
Abstract. Following infections with coronaviruses (e.g., SARS-CoV-2; COVID-19; ICD10: U07) and associated concomitant and secondary diseases, recovered individuals frequently report cognitive, emotional, and motivational complaints. The clinical presentation is complex and typically includes decreased resilience, fatigue, attention and memory impairment as well as executive dysfunction. Persistent functional disorders have been described as part of a “long - / post - COVID” syndrome. After reviewing relevant biomedical information, we associate neuropsychological disorders with pertinent pathogenetic mechanisms and clinical syndromes and derive implications for neuropsychological assessment and therapy. In the context of “Neuro - COVID” rehabilitation, neuropsychology contributes significantly to defining effect criteria and treatment needs in patient subgroups, to predict disease courses and treatment outcomes, and to improve decision-making in the context of treatment scheduling.
Einleitung
Die im Herbst 2019 erstmalig aufgetretene Viruserkrankung des Typs COVID-19 (Corona Virus Disease 2019; ICD-10: U07), welche durch das Betacoronavirus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus type2) ausgelöst wird, hat weltweit über 237 Millionen registrierte Infektionen und mindestens 4.8 Millionen Todesopfer gefordert (World Health Organization [WHO], 2021b). In Deutschland wurden bis zu diesem Zeitpunkt insgesamt 4 323 346 infizierte Personen registriert, von denen 94 308 (2.2 %) verstarben (Johns Hopkins University & Medicine, 2021). Nach erfolgreicher Entwicklung von Impfstoffen (Sharma, Sultan, Ding & Triggle, 2020) erfolgte im Dezember 2020 eine erste Zulassung in Deutschland, sodass seit Januar 2021 mit der Impfung von Risikogruppen begonnen wurde; vollständig geimpft wurden 65.3 % der Bevölkerung (Robert Koch Institut [RKI]; 2021b).
Das zunehmende Wissen über die Wirkungsweisen der Coronaviren gibt Anlass für Hoffnung und Sorge zugleich: Eine Infektion kann nicht nur ein schweres Atemwegssyndrom auslösen, sondern scheint auch für langfristige Folgeerkrankungen verantwortlich zu sein. So geben frühere Betaviruspandemien (SARS-CoV-1; Middle East Respiratory Syndrom [MERS]) bereits erste Hinweise auf fortdauernde neurokognitive Beeinträchtigungen und psychische Störungen bei Betroffenen (Lam et al., 2009). Aufgrund dieser Komplikationen und neuer Ergebnisse zu den langfristigen Folgen COVID-19-assoziierter Erkrankungen, insbesondere Affektionen des Zentralnervensystems (ZNS) („Neuro-COVID“), ist von einer steigenden Zahl von COVID-19-Genesenen mit fortbestehenden neuropsychologischen Beeinträchtigungen auszugehen (Troyer, Kohn & Hong, 2020; Wilson, Betteridge & Fish, 2020). Allein die große Zahl der ehemals hospitalisierten Überlebenden (200 858 Personen; RKI, 2021f) kennzeichnet das Ausmaß der anstehenden Herausforderungen für das Gesundheitswesen (Roessler et al., 2021).
Nachdem die WHO Schlüsselnummern für persistierende Post-COVID-19-Zustände vergeben hatte, veröffentlichte die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. (AWMF) 2021 eine S1-Leitlinie für das „Post-/Long-COVID“-Syndrom (Koczulla et al., 2021; siehe Abschnitt „Vorgeschichte und Hintergrund“). Letztere nimmt jedoch nur marginal auf das neuropsychologische Fachgebiet Bezug und bietet deshalb Anlass für weitere Diskussionen. Erste Antworten und Vorüberlegungen zum Zweck einer internationalen Harmonisierung der neuropsychologischen Diagnostik vermittelt eine Vorabpublikation der Ad-hoc-Arbeitsgruppe „NeuroCOVID International Neuropsychology Taskforce“ (Cysique et al., 2021). Es wird darin jedoch keine Rücksicht auf die Heterogenität der Gruppe der Erkrankten und die daraus resultierenden unterschiedlichen Bedürfnisse bezüglich neuropsychologischer Diagnostik und Therapie genommen.
Vor diesem Hintergrund ergeben sich für das Gebiet der neuropsychologischen Diagnostik und Rehabilitation eine Reihe vertiefend zu behandelnder Fragen und Herausforderungen: Wie kann bei Patientinnen und Patienten mit SARS-CoV-2-assoziierten Erkrankungen, welche direkt oder mittelbar durch hirnorganische Veränderungen hervorgerufen wurden, eine systematische Erfassung von subjektiven Beschwerden sowie von kognitiven und verhaltensbezogenen Funktionsbeeinträchtigungen umgesetzt werden, unter der Prämisse, dass dies effizient (unter Berücksichtigung von Aufwand und Nutzen) und methodisch angemessen erfolgt? Können anhand von neuropsychologischen Kriterien spezifische Behandlungsbedürfnisse für Untergruppen von Betroffenen spezifiziert werden? Können Personen, die ein erhöhtes Risiko für neuropsychologische Folgestörungen aufweisen, frühzeitig erkannt werden? Ist es möglich, Krankheitsverläufe und Behandlungsergebnisse anhand neuropsychologischer Effektkriterien besser zu prognostizieren? Welche neuropsychologischen Entscheidungshilfen können im Hinblick auf die Planung des Rehabilitationsprozesses bereitgestellt werden?
Die Datenlage erlaubt diesbezüglich noch keine abschließenden Bewertungen, dennoch können Randbedingungen des neuropsychologischen Handelns analysiert und daraus erste Implikationen abgeleitet werden. Zu diesem Zweck werden nach einer selektiven Übersicht relevanter Hintergrundinformationen die mit den coronavirusassoziierten Erkrankungen in Verbindung stehenden zentralen neuropsychologischen Funktionsstörungen und organischen Persönlichkeitsveränderungen beschrieben, soweit diese für die Diagnostik und Rehabilitation relevant sind (Abschnitt „Allgemeine Funktionsstörungen“). Anschließend werden biomedizinisch fundierte Erklärungen hirnorganischer Veränderungen durch Coronaviren zusammengefasst, wobei insbesondere auf immunologische Mechanismen eingegangen wird (Abschnitt „Pathogenetische Mechanismen und hirnorganische Veränderungen“). Nachfolgend werden die bei den jeweiligen Erkrankungen zu erwartenden, speziellen Funktionsstörungen erörtert (Abschnitt „Spezielle neuropsychologische Funktionsstörungen“). Abschließend werden Implikationen für die neuropsychologische Diagnostik und Rehabilitation in den verschiedenen Erholungsphasen diskutiert (Abschnitt „Implikationen für die neuropsychologische Diagnostik und Rehabilitation“).
Vorgeschichte und Hintergrund
Innerhalb der letzten beiden Jahrzehnte ist SARS-CoV-2 die dritte durch Betacoronaviren ausgelöste Erkrankung der Atemwege. Bereits im Jahr 2003 erkrankten über 8000 Menschen an SARS-CoV-1, wobei eine Letalitätsrate von 11 % beobachtet wurde (World Health Organization, 2003). Im April 2012 erkrankten erstmalig Personen an dem MERS-Syndrom; diese Atemwegserkrankung wurde bei 2279 Personen zumeist auf der arabischen Halbinsel und angrenzenden Ländern bestätigt. Die Sterblichkeitsrate lag bei 35 % (World Health Organization, 2019). Die Erkenntnisse zu der seit 2019 durch COVID-19 verursachten Pandemie bauen daher auf dem vorliegenden Wissen zur Wirkungsweise früherer Coronaviren auf. Die benannten Coronaviren weisen ein ähnliches Erbgut (SARS-CoV-2 und SARS-CoV-1: 80 %; SARS-CoV-2 und MERS: 50 %), eine ähnliche Morphologie und Symptomatik auf (Rothan & Byrareddy, 2020). Daher liegt es nahe, auch die neuropsychologischen Auswirkungen dieser drei Virusvarianten gesammelt zu betrachten.
Epidemiologie
Seit dem ersten Auftreten des SARS-CoV-2 im Herbst 2019 entwickelte sich seit März 2020 laut WHO ein pandemisches Geschehen. Nach einer ersten Welle, gefolgt von einem ersten Lockdown im Frühjahr 2020, wurde während einer zweiten Welle im Herbst 2020 ein markanter Anstieg mit bis zu R = 1.5 festgestellt. Aufgrund staatlicher Kontrollmaßnahmen konnte bis zum Januar 2021 ein Absinken der Reproduktionszahlen erreicht werden (Statista, 2021). Die besonders kontagiösen Virusvarianten (z. B. B.1.1.7/Alpha) führten nachfolgend jedoch zu einem weiteren Anstieg, sodass das RKI den Beginn einer dritten Welle konstatierte (RKI, 2021a). Die zunehmende Anzahl geimpfter Personen ließ auf einen Rückgang hoffen, jedoch konnte aufgrund der Verbreitung neuer Virusmutanten (B.1.617.2/Delta) die Entstehung einer weiteren Welle nicht verhindert werden (RKI, 2021e).
Übertragung und Verlauf
Da für SARS-CoV-2 eine Verbindung zu einem Wet-Market in Wuhan, China, vermutet wurde, liegt ebenso wie für SARS-CoV-1 und MERS die Annahme einer Zoonose (zwischen Menschen und Vertebraten übertragbare Erkrankung) nahe. Die Annahme, dass die Transmission durch infizierte Fledermäuse erfolgte (Shereen, Khan, Kazmi, Bashir & Siddique, 2020), ist jedoch noch nicht gesichert. Die Übertragung zwischen Menschen erfolgt im Allgemeinen durch Aerosole (Speicheltröpfchen), die beim Husten, Niesen oder Sprechen ausgeschleudert werden und sich lange in der Raumluft halten und verteilen (McIntosh, Hirsch & Bloom, 2020). Die Inkubationszeit wird bei den drei bisherigen Betacoronaviren auf bis zu 14 Tage (Mittelwert 5 bis 6 Tage) geschätzt (WHO, 2021b). Die COVID-19-Erkrankung dauert bei mildem Verlauf durchschnittlich 2 bis 3 Wochen an, in schweren Fällen ist mit 3 bis 6 Wochen zu rechnen (RKI, 2020). Bei mindestens 13 % der Erkrankten soll postakut ein Post-/Long-COVID-Syndrom auftreten (siehe unten).
Risikofaktoren
Die Notwendigkeit einer intensivmedizinischen Behandlung und Beatmung ist je nach Krankheitsverlauf und Schweregrad sehr unterschiedlich (RKI, 2020). Bekannte Risikofaktoren für schwere Verläufe sind: höheres Lebensalter, männliches Geschlecht, Adipositas, Trisomie 21, Herz-Kreislauf-Krankheiten, chronische Lungenerkrankungen wie COPD, Diabetes mellitus und Krebserkrankungen (WHO, 2021a). Bei COVID-19-Erkrankten wurde des Weiteren im gesamten Genom nach Risikofaktoren geforscht. Bestimmte Genvarianten scheinen mit einer erhöhten Immunreaktivität verbunden, die in Kombination mit weiteren Risikofaktoren schwerere Krankheitsverläufe prädizieren könnten (Debnath, Banerjee & Berk, 2020), allerdings sind direkte kausale Aussagen nicht möglich (Schäfer & Baric, 2017). Es stellt sich für die Neuropsychologie die Frage, welche genetischen Faktoren Personen auszeichnen, die bezüglich langfristiger neurokognitiver Beeinträchtigungen gefährdet sein könnten. In einer aktuellen Studie wurde das Gen ApoE, welches insbesondere mit der Alzheimer-Demenz assoziiert ist, mit einem höheren Risiko eines schweren COVID-19-Krankheitsverlaufs in Verbindung gebracht (Finch & Kulminski, 2021). Neurologische Erkrankungen, die oftmals mit neuropsychologischen Beeinträchtigungen verbunden sind, gehören ebenfalls zu den Risikofaktoren schwererer COVID-19-Verläufe (De Felice, Tovar-Moll, Moll, Munoz & Ferreira, 2020; Ferini-Strambi & Salsone, 2021). Obwohl Kinder im Allgemeinen weniger schwer zu erkranken scheinen, kann auch diese Gruppe in einigen Fällen negative Gesundheitseffekte mit neuropsychologischen Symptomen erleiden (Toraih et al., 2021). Welche der Betroffenen neuropsychologische Folgestörungen entwickeln könnten, ist eine der aktuellen Kernfragen der Neuropsychologie. Die zunehmenden Kenntnisse der jeweiligen Risikofaktoren könnten dazu beitragen, ungünstige Verläufe auch auf neuropsychologischem Gebiet frühzeitig zu erkennen.
Symptomatik
Die registrierten Symptome deuten auf eine systemische Wirkungsweise der Coronaviren hin. Es lassen sich akute, direkte Krankheitssymptome und indirekt vermittelte Folgeerkrankungen oder Schädigungen des Organismus sowie daraus ableitbare residuale Funktionsstörungen unterscheiden. Abbildung 1 vermittelt eine Übersicht allgemeiner Angriffsstellen der Coronaviren, insbesondere derjenigen, die mit neuropsychologisch relevanten Spätfolgen verbunden sein können.
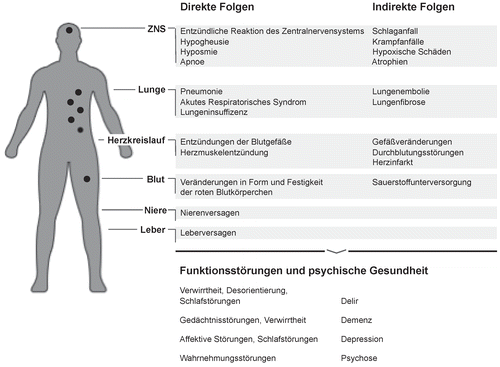
Im Akutstadium können die drei genannten Coronavirustypen Fieber und gastrointestinale Beschwerden auslösen. Bei allen gilt Husten als zentrales Merkmal. Eine Pneumonie, das Akute Respiratorische Syndrom (Acute Respiratory Distress Syndrom [ARDS]) bis hin zur respiratorischen Insuffizienz sind mögliche Folgen. Das Ausmaß potenzieller Organschäden scheint mit der Intensität und Dauer der Erkrankung korreliert (Zaim, Chong, Sankaranarayanan & Harky, 2020). Der Ständige Arbeitskreis der Kompetenz- und Behandlungszentren für Krankheiten durch hochpathogene Erreger am RKI (STAKOB) schlug eine Unterteilung in leichte Erkrankungen (ohne Pneumonie), moderate Erkrankungen (mit Pneumonie) und schwere Erkrankungen (mit schwerer Pneumonie) vor. Die kritische Erkrankung wurde als weitere Unterklasse benannt, die entweder durch ein Hyperinflammationssyndrom oder ARDS gekennzeichnet ist (Ständiger Arbeitskreis der Kompetenz- und Behandlungszentren für Krankheiten durch hochpathogene Erreger am Robert Koch-Institut, 2021)
Die Bandbreite der coronavirusassoziierten Symptome ist groß. So waren MERS-Infektionen mit Nierenschädigungen assoziiert; SARS-CoV-1 und 2 scheinen eine Veränderung der Immunantwort auszulösen, wobei ein Mangel an Leukozyten und Lymphozyten beobachtet wurde (Gu et al., 2005; Guan et al., 2020). SARS-CoV-2 ging zusätzlich mit einer Verminderung der Zahl der Thrombozyten und einer Veränderung der Eigenschaften und Form von Blutzellen einher (Kubánková et al., 2021) und wurde in einzelnen Fällen mit kardialen Insuffizienzen in Verbindung gebracht. Bei allen Coronavirusgruppen wurden jedoch auch asymptomatische Verläufe beobachtet (Abdelrahman, Li & Wang, 2020).
Bei SARS-CoV-2-Erkrankungen scheint eine direkte oder indirekte Beteiligung des ZNS relativ häufig aufzutreten. Mao et al. (2020) fanden bei 36.4 % der Betroffenen neurologische Symptome wie Kopfschmerzen, Bewusstseinsstörungen bis hin zu Schwindel und Krampfanfällen. Bei einer deutschen Stichprobe fanden sich neurologische Symptome bei 59.8 % der Untersuchten (Fleischer et al., 2021). Eine umfangreiche neuere deutsche Kohortenstudie fand sowohl bei betroffenen Erwachsenen als auch Kindern signifikant erhöhte Diagnosehäufigkeiten für neurologische und psychische Erkrankungen (Roessler et al., 2021). Neurologische Symptome sind sowohl für Diagnose als auch Prognose der COVID-19-Erkrankung und möglicher neuropsychologischer Langzeitfolgen relevant (Nouchi et al., 2021; Yan, Faraji, Prajapati, Ostrander & DeConde, 2020).
Aufgrund der Neuartigkeit von COVID-19 können aktuell noch keine zuverlässigen Schlussfolgerungen zu Langzeiteffekten gezogen werden. Studien zu früheren Coronaviruserkrankungen und erste Studienergebnisse zu SARS-CoV-2 ermöglichen Anhaltspunkte möglicher Folgeerkrankungen langfristigen Funktionsstörungen: So können pulmonale Langzeitfolgen mit verminderter Lungenfunktion oft noch Jahre anhalten (Hui et al., 2005). Bei Genesenen konnten noch Wochen nach einer Infektion erhöhte Entzündungsbotenstoffe im Blut nachgewiesen werden (Ong et al., 2020). Langfristig wurden grippeartige Symptome sowie starke Erschöpfung, Schwäche, Kopf- und Muskelschmerzen beschrieben. In Italien erfassten Carfì, Bernabei und Landi (2020) langfristige Beschwerden bei 143 zuvor wegen SARS-CoV-2 stationär aufgenommenen Personen (Altersdurchschnitt 56.5 Jahre, SD 14.6 Jahre; 37 % Frauen, 63 % Männer). Diese wurden sowohl in der Akutphase als auch 60.3 Tage (SD 13.6) nach Auftreten der ersten Symptome untersucht. Die durchschnittliche Länge der Hospitalisierung betrug 13.5 Tage (SD 9.7 Tage). Die Ergebnisse belegen, dass die Lebensqualität bei 44.1 % der Genesenen auch Wochen nach der Erkrankung deutlich reduziert war. Insbesondere litten mehr als die Hälfte der Betroffenen auch nach zwei Monaten noch unter einer Erschöpfungssymptomatik (53.1 %). Dyspnoe wurde bei 43.4 %, Glieder- und Brustschmerzen bei 27.3 % dokumentiert. Eine Untersuchung an jüngeren, 18- bis 34-jährige Personen, zeigt andauernde Folgestörungen wie eine Erschöpfungssymptomatik und reduzierte Lebensqualität (Tenforde et al., 2020).
Klassifikation
Im Januar 2021 hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) die ICD-10-GM nach den Vorgaben der WHO angepasst und unter U08- bis U10 drei neue Schlüsselnummern für die Klassifikation der Post-coronavirusassoziierten Erkrankungen aufgenommen: U10.9 kodiert das akute multisystemische Entzündungssyndrom in Verbindung mit COVID-19. U08.9 (COVID-19 in der Eigenanamnese) soll vergeben werden, wenn eine bestätigte Coronaviruskrankheit vorlag, die den Gesundheitszustand einer Person weiter beeinflusst, eine aktuelle Infektion jedoch nicht mehr vorliegt. U09.9 (Post-COVID-19-Zustand) bezeichnet eine anderenorts klassifizierte Störung, inklusive des chronischen Erschöpfungssyndroms (Chronisches Fatigue-Syndrom [CFS]; ICD-10: G93.3; Sotzny et al., 2018), die im Zusammenhang mit einer vorausgegangenen COVID-19-Erkrankung steht. Das „Long-COVID-Syndrom“ (ab 4 Wochen seit Infektion) sowie das „Post-COVID-Syndrom“ (ab 12 Wochen seit Infektion) wurden in einer S1-Leitlinie der AWMF detailliert beschrieben (Koczulla et al., 2021). Bei Genesenen, die über mehrere Monate hinweg eine übermäßige und unverhältnismäßige Aufmerksamkeit auf ihre körperlichen Beschwerden richten, könnte ggf. auch eine Körperliche Belastungsstörung (Bodily distress disorder, ICD-11; First, Reed, Hyman & Saxena, 2015) vorliegen. Diese ist mit anhaltendem Leidensdruck und erheblichen Beeinträchtigungen in verschiedenen Funktionsbereichen verbunden und geht gelegentlich mit Müdigkeit oder Schmerzen einher (siehe auch den Fallbericht von Bodenburg [2021] in diesem Heft).
Coronavirusassoziierte Erkrankungen als Gegenstand der Neuropsychologie
Die systemischen Effekte der coronavirusassoziierten Erkrankungen können direkt oder indirekt auch für neuropsychologische Funktionsstörungen verantwortlich sein, welche ihrerseits die Lebensqualität der Betroffenen maßgeblich beeinflussen. Deshalb ist es von hoher Relevanz, die Zusammenhänge zwischen den komplexen bio-morphologischen Veränderungen durch das Infektionsgeschehen einerseits und den neurokognitiven, emotionalen und motivationalen Beeinträchtigungen andererseits genauer zu spezifizieren. Ein fundiertes Wissen über diese Zusammenhänge ist eine wesentliche Grundlage für das hypothesengeleitete, neuropsychologische Assessment und die individualisierte Behandlungsplanung.
Die Relevanz für die Neuropsychologie ergibt sich auch aus den hohen Fallzahlen der potenziell Betroffenen. Der Index der weltweiten klinischen Manifestation der Erkrankung wurde auf 55 bis 85 % geschätzt (RKI, 2021c). Laut dem Ständigen Arbeitskreis der Kompetenz- und Behandlungszentren für Krankheiten durch hochpathogene Erreger am Robert Koch Institut (STAKOB) weisen etwa 14 % der Erkrankten einen schwereren und etwa 5 % einen kritischen Krankheitsverlauf auf (STAKOB, Stand 28.04.2021). Wie viele der deutschlandweit mehr als 3 Millionen Genesenen langfristige neurologische und/oder neuropsychologische Symptome entwickeln werden, bleibt zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund des nicht endgültig aufgeklärten Zusammenhangs zwischen akuten und langfristigen Beeinträchtigungen unsicher. Geht man hypothetisch davon aus, dass bei 19 % der Genesenen mit schweren bzw. kritischen Verläufen spätere Komplikationen auftreten, wäre deutschlandweit mit über 570 000 Personen zu rechnen, die einer Rehabilitation bedürfen.
Bei den postakuten Krankheitsfolgeerscheinungen der Post-/Long-COVID-Syndrome und des CFS handelt es sich um symptom- und diagnosebezogene Klassifikationsversuche, die auf Selbstberichten und klinischen Beobachtungen beruhen. Es bleibt allerdings diskussionswürdig, ob diese deskriptiven Konstrukte zur Klärung der Ursachen, Verläufe und Erfolgsaussichten von Rehabilitationsbehandlungen beitragen. Bei der Klassifikation der COVID-19-Folgeerkrankungen sollten die Vorschläge des Research Domain Criteria Projects (RDoC) des National Institute of Mental Health (NIMH) Berücksichtigung finden, die eine stärkere Beachtung verhaltensneurowissenschaftlicher Konstrukte und Modellbildungen fordern. Daraus leitet sich auch ein Auftrag an die Klinische Neuropsychologie ab, die aus pathophysiologischen Veränderungen des Gehirns resultierenden, oft auch minimalen neuropsychologischen Funktionsstörungen genauer zu erfassen, zu erklären und zu behandeln. Da gut bekannt ist, dass aufgrund entzündlicher oder traumatischer Prozesse langfristige Funktionsstörungen bzw. organische Persönlichkeitsveränderungen entstehen können (Calaprese & Penner, 2009; Wallesch & Bartels, 2009) und erste Hinweise auf einen verminderten Metabolismus in ventralen Hirnregionen bei COVID-19-Betroffenen mit chronischen Beschwerden vorliegen (Guedj et al., 2021), ist eine detaillierte neuropsychologische Diagnostik im Bereich der COVID-19-assoziierten Folgeerkrankungen angemessen. Die einschlägigen Leitlinien (siehe auch Abschnitt „Diagnostische Prozesse in den Rehabilitationsphasen“) weisen auf das Erfordernis des Einbezugs der Neuropsychologie als einschlägig heilkundlich ausgewiesener Disziplin hin.
Neuropsychologische Funktionsstörungen
Die durch Coronaviren und assoziierte Erkrankungen vermittelten hirnorganischen Veränderungen können zahlreiche psychische Funktionsstörungen zur Folge haben, welche wiederum für Einschränkungen der Aktivitäten des täglichen Lebens verantwortlich sein können. Im Hinblick auf die Problemanalyse und Zielsetzung der Rehabilitation der COVID-19-Genesenen ist das Wissen über COVID-19-typische Beeinträchtigungen der kognitiven, emotionalen und motivationalen Funktionen, der Körperfunktionen, Aktivitäten und der Partizipation von großer Bedeutung. Deshalb werden nachfolgend erstens allgemeine Ergebnisse symptomorientierter Screeninguntersuchungen zum neuropsychologischen Erscheinungsbild resümiert und zweitens die ätiologisch relevanten, neuropathologischen Mechanismen und klinischen Syndrome zusammengefasst. Darauf aufbauend betrachten wir in einem dritten Schritt die speziellen neuropsychologischen Beeinträchtigungen, die bei assoziierten Erkrankungen zu erwarten sind.
Allgemeine Funktionsstörungen
Bereits im Gefolge der „Spanischen Grippe“ (um 1918) wurde – neben neuropsychiatrischen Symptomen wie Krampfanfällen und Psychosen – eine erhöhte Zahl von Verhaltensauffälligkeiten beobachtet (Menninger, 1926). Aktuelle Ergebnisse zu den Folgen der COVID-19- Pandemie deuten ebenfalls darauf hin, dass bereits nach relativ milden Verläufen zahlreiche Beeinträchtigungen kognitiver, emotionaler und motivationaler Funktionen bei Genesenen fortbestehen können. So zeigte die Metaanalyse von Lopez-Leon et al. (2021), dass in erster Linie eine reduzierte Belastbarkeit und erhöhte Müdigkeit (58 % der COVID-19-Betroffenen), Kopfschmerzen (44 %), Aufmerksamkeitsstörungen (27 %) sowie Gedächtnisprobleme (16 %) berichtet wurden. Hervorzuheben ist eine neuere Studie von Becker, Lin, Doernberg, Stone, Navis,Festa, und Wisnivesky (2021), die 740 Betroffene im Alter von 38–59 Jahren 7.6 Monate nach Diagnosestellung einer SARS-CoV-2 Infektion untersuchten. 18 % wiesen Beeinträchtigungen der Verarbeitungsgeschwindigkeit, 16 % der exekutiven Funktionen, 15–20 % der Wortflüssigkeit, sowie 24 % der Gedächtnisfunktionen auf.
Müdigkeit, Antrieb und Anstrengungsbereitschaft
Die häufigen Berichte über eine andauernde Müdigkeit von COVID-19-Genesenen wurden im Sinne einer Postinfektiösen Fatigue und als Bestandteil eines Post-COVID-Syndroms interpretiert (z. B. Lamprecht, 2020). Ebenso wurde das Konzept des CFS herangezogen, zu dessen Kernsymptomen eine Belastungsintoleranz nach geringer körperlicher oder geistiger Aktivität zählt. Kognitive Funktionsstörungen inkludieren Konzentrations- und Gedächtnisprobleme. Chronische Kopf-, Muskel- und Gliederschmerzen, Magen-Darm-Probleme und Schlafstörungen treten hinzu. Die Lebensqualität der Betroffenen ist insgesamt deutlich reduziert (Clayton, 2015).
Bei diesen Syndromen handelt es sich um deskriptive Sammelbezeichnungen, welche das komplexe Geschehen auf wenige, wiederkehrende Kernprobleme verdichten sollen. Als Krankheitsbezeichnung erscheinen diese jedoch weniger geeignet. Clayton (2015) hinterfragte die Validität des CFS und schlug eine Neudefinition und Umbenennung im Sinne einer „Systemischen Anstrengungsintoleranz“ (Systemic exertion intolerance disease [SEID]) vor. Diese setzt eine länger als 6 Monate anhaltende Einschränkung der Teilhabe in verschiedenen Lebensbereichen aufgrund markanter Müdigkeit voraus, die nicht das Ergebnis einer erschöpfenden Aktivität ist. Erholungsphasen und Schlaf haben hierbei keinen erleichternden Effekt auf die erlebten Beeinträchtigungen. SEID umfasst ebenfalls kognitive Beeinträchtigungen.
Auch wenn die ICD-11 neuerdings das CFS unter dem Begriff „Postviral fatigue syndrome“ (8E49) als neurologische Erkrankung subsummiert, bleiben ursächliche Aspekte ungeklärt. Diskutiert wird, dass Müdigkeit sich durch ein Zusammenwirken mehrerer Faktoren manifestiert, die sowohl das Nerven- und Immunsystem als auch den Energiestoffwechsel betreffen (Kristiansen et al., 2019). Auch eine maladaptive Verhaltensregulation während der Erkrankung wurde vorgeschlagen: So postuliert die AWMF-S3-Leitlinie „Müdigkeit“ (AWMF, 2017) ein komplexes Zusammenwirken somatischer, psychosozialer und biologischer Faktoren. Demnach könnten die während einer Virusinfektion erlebten Symptome (mangelnde Leistungsfähigkeit, Muskelschmerzen etc.) kognitive und behaviorale maladaptive Copingmechanismen auslösen: Die Wahrnehmung der Betroffenen, unter einer körperlichen Erkrankung zu leiden, deren Symptome sich durch physische oder psychische Belastung verstärken, könnte demnach zu einem Vermeidungsverhalten beitragen. Physiologische Sekundärveränderungen der fehlenden Aktivität verstärkten demnach die subjektiv empfundene Assoziation von Belastung und Symptomexazerbation. Dies soll letztlich vermeidendes Verhalten, sozialen Rückzug und depressive Stimmung begünstigen (AWMF, 2017). Die Leitlinie räumt jedoch ein, dass es sich um hypothetische Überlegungen handele, die von Betroffenen oftmals negiert würden.
Aus neuropsychologischer Perspektive stellt sich Müdigkeit als eine relativ unspezifische Beeinträchtigung mit Bezügen zu Antrieb, Aufmerksamkeit und Anstrengungsbereitschaft dar. Ursachen, Konsequenzen und Behandlungsmöglichkeiten sind vielfältiger Natur. Potenzielle Defizite sind unter Berücksichtigung der spezifischen hirnorganischen Ätiologie und psychosozialen Faktoren zu spezifizieren, sodass Rehabilitationsziele und Behandlungsansätze begründet werden können (siehe Abschnitt „Implikationen für die neuropsychologische Diagnostik und Rehabilitation“).
Kognitive Störungen
Während die Assoziation von grippalen Infekten und dem subjektiven Allgemeinbefinden gut dokumentiert ist, erscheint die Forschungslage in Bezug auf kognitive Defizite lückenhaft. Spezifische Defizitprofile nach viralen Grippeinfektionen sind nicht bekannt, jedoch scheint das Ausmaß einer Entzündungsreaktion für die Entwicklung kognitiver Störungen und Verhaltensänderungen ausschlaggebend zu sein. Zum Beispiel zeigte eine experimentelle Studie mit influenzavirusinfizierten Mäusen spezifische neuronale Veränderungen, wobei die Entzündungsreaktion zu einer Reduktion der neuronalen Plastizität im Bereich des Hippocampus und zu assoziierten neurokognitiven Minderleistungen führte (Jurgens Amancherla & Johnson, 2012). Auch beim Menschen ist ein gemeinsames Auftreten von viralen Erkrankungen und Verhaltensänderungen beobachtet worden. Im Akutstadium grippaler Infekte, einschließlich der Coronavireninfektion, sind Bewusstseinseinschränkungen häufig (Walter & Carraretto, 2016). Die Datenlage zu distinkten neuropsychologischen Effekten nach grippalen Infekten ist jedoch unvollständig. Die beobachteten Effekte sind vermutlich in vielen Fällen auf Begleit- und Folgeerkrankungen zurückzuführen (Abschnitt „Spezielle neuropsychologische Funktionsstörungen“).
Emotionale Störungen
Es ist gut bekannt, dass sich nach entzündlichen ZNS-Erkrankungen affektive Beeinträchtigungen manifestieren können. So können im Gefolge von MS, Polyneuropathien, Neuroborreliose und anderen Infektionskrankheiten psychische Beeinträchtigungen auftreten, welche teilweise komorbid mit neurokognitiven Defiziten einhergehen (Calabrese & Penner, 2009). Eine Metaanalyse zur psychischen Gesundheit bei SARS-CoV-1 zeigte, dass die Anzahl klinisch behandlungsbedürftiger Störungen auch nach Jahren noch deutlich erhöht ist (Mak, Chu, Pan, Yiu & Chan, 2009). Lam et al. (2009) untersuchten SARS-CoV-1-Erkrankte 2 Jahre nach Krankheitsbeginn und fanden bei 54.5 % der Untersuchten Anzeichen einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS); 39 % litten weiterhin unter depressiven Symptomen, 36.4 % klagten über chronische Schmerzen, 32.5 % zeigten eine Panikstörung und 15.6 % zeigten Anzeichen einer Zwangsstörung. Prämorbid wurden jedoch nur bei 3 % dieser Personen psychopathologische Symptome festgestellt.
Im Jahr 2011 wurden in Toronto relativ junge Patientinnen und Patienten mit ARDS (N = 109, M = 44 Jahre, IQR 35–57 Jahre) nach einer intensivmedizinischen Behandlung verlaufsuntersucht. Auch nach 5 Jahren konnten deutliche Unterschiede bezüglich der psychischen und physischen Gesundheit im Vergleich zu einer nicht erkrankten Gruppe festgestellt werden. Viele der Betroffenen litten neben Erschöpfungssymptomen und Muskelschwäche auch unter affektiven Störungen wie Depressionen, Isolationsängsten und PTBS. Ein Jahr nach Erkrankung waren nur 48 % der Genesenen berufstätig. Nach 5 Jahren standen zwar 77 % der Betroffenen wieder in einem Arbeitsverhältnis, jedoch waren häufig Wiedereingliederungshilfen oder angepasste Arbeitsstunden erforderlich (Herridge et al., 2011).
Im Jahr 2016 fand eine Studie mit großem Stichprobenumfang (N = 103 307) signifikante Korrelationen zwischen einer Grippevirusinfektion und assoziierten depressiven Beeinträchtigungen (Bornand, Toovey, Jick & Meier, 2016). Umgekehrt untersuchten Okusaga et al. (2011) Personen mit affektiven Erkrankungen bezüglich viraler Antikörper. Bei 80 bis 86 % dieser Gruppe (Kontrollgruppe: 41 %) fand sich eine Assoziation von depressiven Symptomen bzw. Suizidalität und erhöhten Antikörpern. Diese Beispiele weisen auf eine mögliche Verbindung von viralem Geschehen und affektiven Störungen hin, wobei kausale Rückschlüsse auf diese Weise nicht gezogen werden konnten. Diese Studien deuten daher auf ein mögliches Fortbestehen emotionaler Dysfunktionen nach viralen Infektionen hin. Dies inkludiert die SARS-CoV-1-Erkrankung (Hopkins et al., 2005; Lam et al., 2009) ebenso wie, aller Voraussicht nach, die SARS-CoV-2-Erkrankungen.
Pathogenetische Mechanismen und hirnorganische Veränderungen
Schädigungen des Zentralen Nervensystems
Da Coronaviren neuroinvasiv sein können (Gu et al., 2005; Wu et al., 2020), ist mit schweren akuten Infekten des ZNS zu rechnen. Die durch neurotrope Viren hervorgerufenen Symptome sind komplex und können ohne Kenntnis der Wirkungsmechanismen und der betroffenen Hirnregionen kaum spezifiziert werden. Als mögliche Infektionswege wurden die Blutzirkulation und/oder freie Nervenendigungen des Bulbus olfactorius in Betracht gezogen (Stevens, 2020). Im ZNS kann sich das Virus nachfolgend verbreiten. Bereits nach der SARS-CoV-1-Pandemie wurden neuropathologische Veränderungen berichtet: So fanden sich in Post-mortem-Analysen Viruspartikel im neuronalen Zytoplasma, Hypothalamus und Kortex (Gu et al., 2005). Weitere Pathologien waren Polyneuropathien, Krampfanfälle sowie thrombotische Prozesse (Tai et al., 2020; Wu et al., 2020). Die Datenlage zu MERS ist aufgrund der geringen Fallzahlen begrenzt: Eine ältere Studie mit 70 Patientinnen und Patienten zeigte, dass ein Viertel der untersuchten Erkrankten akute Störungen der Hirnfunktionen und damit verbundene temporäre Verwirrtheitszustände aufwiesen (Saad et al., 2014). In einer Post-mortem-Analyse bei 40 an COVID-19 Verstorbenen wurden das ZNS auf die Neuroinvasivität von SARS-CoV-2 untersucht: Bei 53 % der Betroffenen konnte das Virus im ZNS, insbesondere in tiefen Hirnstrukturen, entdeckt werden. Ein korrelativer Zusammenhang mit dem Ausmaß neuropathologischer Veränderungen wie Ischämien oder Astrogliosen (vermehrtes Auftreten veränderter Astrozyten aufgrund des Untergangs benachbarter Nervenzellen) wurde nicht beobachtet (Matschke et al., 2020). Eine akute Infiltration tief liegender Hirnregionen, welche die Atemzentren des Hirnstamms einschließt, könnte u. a. für Atemstörungen verantwortlich sein (Gandhi, Srivastava, Ray & Tripathi, 2020).
Ergebnisse zu verschiedenen virusbedingten Krankheitsbildern (Enzephalitis, Meningitis, Meningoenzephalitis) deuten darauf hin, dass das Ausmaß der chronischen Schädigung im Allgemeinen vom Grad der Zytotoxizität, der Dauer sowie von der Art des Virusbefalls abhängt. Akute oder schleichende neurokognitive und neuropsychiatrische Veränderungen unterschiedlicher Art sind nicht immer vollständig reversibel: So leiden viele Betroffene nach einer Herpes-Simplex-Enzephalitis postmorbid an mnestischen und affektiven Dysfunktionen (Calabrese & Penner, 2009).
Immunologische Mechanismen
Coronaviruserkrankungen können das Risiko langfristiger Gesundheitsbeeinträchtigungen aufgrund der starken Beteiligung immunologischer Prozesse erhöhen. Entzündungsreaktionen in einer relativ späten Phase des akuten Infektionsgeschehens können eine übermäßige Ausschüttung von Zytokinen („Hyperinflammationssyndrom“; Feldt et al., 2020) anregen oder die Produktion von Antikörpern postinfektiös steigern (Burr, Barton, Doll, Lakhotia & Sweeney, 2021; Panariello et al., 2020; Zandifar & Badrfam, 2021), was einen ungünstigen Verlauf der COVID-19-Infektion zur Folge haben kann. Betroffene mit einer Autoimmunerkrankung scheinen einen schwereren Verlauf der Erkrankung aufzuweisen (Akiyama, Hamdeh, Micic & Sakuraba, 2021), jedoch erlauben diese Komorbiditäten noch keine Aussagen über die kausalen Zusammenhänge zwischen Infektion, Immunreaktion und hirnorganischen Veränderungen.
Die Mechanismen der immunologischen Dysregulation und deren Behandlung werden derzeit bezüglich ihrer Einflüsse auf das Nervensystem untersucht. Veränderungen der Bluthirnschranke bis hin zu einer akuten nekrotisierenden Enzephalitis wurden beobachtet (Poyiadji et al., 2020). Infizierte Monozyten können offenbar die Bluthirnschranke passieren und die Zytogenausschüttung und Mikrogliafreisetzung modifizieren (Troyer et al., 2020). Zytogene, die u. a. den dopaminergen und cholinergen Signalweg regulieren, können im Fall einer Überregulation neurologische und neuropsychiatrische Veränderungen auslösen (Wilson, Finch & Cohen, 2002).
Entzündliche Erkrankungen des ZNS können durch Antikörper gegen intra- oder extrazelluläre neuronale Antigene vermittelt werden und sind häufig mit kognitiven Auffälligkeiten verbunden (Wagner-Altendorf, Cirkel & Münte, 2021). Insbesondere ist seit 2007 die NMDA (N-Methyl-D-Aspartat-) Rezeptor-Enzephalitis bekannt, die u. a. durch Influenza- und Herpesvieren angeregt wird und mit neurologischen, neuropsychiatrischen und neuropsychologischen Symptomen einhergehen kann. Nach aktuellem Stand ist diese auch durch Coronaviren auslösbar (Burr et al., 2021; Panariello et al., 2020; Zandifar & Badrfam, 2021). Nach einer überstandenen COVID-19-Infektion werden, vermittelt durch eine immunologische Dysregulation, in überproportionalem Maß NMDA-Rezeptor-Antikörper gebildet. Diese binden an die zum glutamatergen System gehörenden NMDA-Rezeptoren. Durch diese Bindung werden u. a. Lernprozesse und die emotionale Befindlichkeit beeinträchtigt. Im Rahmen einer Dysregulation kann es zu einem Überschuss an Dopamin und – entsprechend der Dopaminhypothese der Schizophrenie – zu positiven klinischen Symptomen und neurokognitiven Einschränkungen kommen. Neuropsychologische Untersuchungen der Langzeitfolgen von Coronaviruserkrankungen wiesen u. a. auf eine reduzierte Gedächtnisleistung, exekutive Schwierigkeiten, emotionale Dysregulation und Erschöpfungszustände hin (de Bruijn et al., 2018; Hinkle et al., 2017; siehe unten).
Bei Kindern kann postinfektiös durch eine überschießende Immunantwort ein Hyperinflammationssyndrom (Multisystem inflammatory syndrome in children [MIS-C]) ausgelöst werden. MIS-C ähnelt symptomatisch dem Kawasaki-Syndrom, einer akuten Vaskulitis, die meist bei Kindern unter 5 Jahren auftritt. Die an COVID-19 erkrankten Kinder mit schweren Verläufen waren jedoch vergleichsweise älter (M = 9 Jahre). Da 31.8 % der an MIS-C erkrankten Kinder neurokognitive Symptome aufwiesen (Toraih et al., 2021), deutet sich hier ein signifikantes Handlungsfeld für die neuropsychologische Rehabilitation an.
Hypoxisch bedingte Schädigungen
Ein Mechanismus, der neuronale Schädigungen ohne direkten Kontakt des Virus mit dem ZNS hervorrufen kann, beruht auf der Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff: Eine akute Minderversorgung mit hypoxischer Schädigung wurde mehrfach für COVID-19 bestätigt (Wu et al., 2020). Bereits bei SARS-CoV-1 wurden Hinweise auf einen Sauerstoffmangel und eine reduzierte Blutzirkulation im ZNS festgestellt (Gu et al., 2005). Hypoxische bzw. hypoxämische Hirnschädigungen können auch bei anderen pulmonalen Erkrankungen wie der Chronisch Obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) oder bei Asthma bronchiale auftreten (Dodd, Getov & Jones, 2010; Hopkins, Gale & Weaver, 2006). Respiratorische Erkrankungen können auf neuronaler Ebene mit vergrößerten Ventrikeln, Atrophien, insbesondere des Hippocampus, sowie mit einem Infarktgeschehen einhergehen (Esser et al., 2016; Hopkins et al., 2005; Jackson et al., 2009). Eine markante Sauerstoffunterversorgung kann mit einer deliranten Bewusstseinsstörung verbunden sein, dementsprechend gilt das Delir als akuter Indikator einer pulmonalen Unterfunktion und als Prädiktor eines schweren Verlaufs der COVID-19-Erkrankung (Rogers et al., 2020). Eine Besonderheit von Coronaviruserkrankungen scheint in einem unbemerkten Auftreten der Sauerstoffunterversorgung zu liegen: Aufgrund der verzögerten Behandlungsmöglichkeit kann dies schwere Schäden des ZNS verursachen. 3 % der Coronaviruserkrankten leiden an strukturellen Veränderungen der Lunge, wie sie auch bei anderen schweren Pneumonien oder respiratorischen Insuffizienzen beobachtet wurden (RKI, 2020). Da auch Monate nach einer COVID-19-Erkrankung noch Veränderungen der Größe und Form der Erythrozyten nachgewiesen wurden (Kubánková et al., 2021), könnte dies den langfristig verminderten Sauerstofftransport und die damit assoziierte Belastungsintoleranz sowie neurokognitive Beeinträchtigungen erklären.
Zerebrovaskuläre Folgeerkrankungen
Zerebrovaskuläre Komplikationen wurden bei 5.7 % der COVID-19-Erkrankten mit schwerem Krankheitsverlauf beobachtet (Mao et al., 2020; Nannoni, de Groot, Bell & Markus, 2021). Ursachen für diese Folgeerkrankungen wurden in einer erhöhten Thrombenbildung und Hyperkoagulation vermutet (Avula et al., 2020). Bei 31 % der intensivmedizinisch Behandelten wurde eine erhöhte Thrombenbildung festgestellt (Klok et al., 2020). Thromben können als Embolus in das Gehirn, aber auch in die Lunge und weitere Organe gelangen. Fallberichte eines New Yorker Krankenhauses zeigten, dass Infarkte auch bei jüngeren Patientinnen und Patienten auftraten. Innerhalb von 2 Monaten wurden eine Patientin und vier Patienten im Alter von 33 bis 49 Jahren aufgrund eines COVID-19-assoziierten ischämischen Infarkts behandelt. Drei der Betroffenen wiesen aufgrund von Vorerkrankungen ein erhöhtes Schlaganfallrisiko auf. Die Infarktlokalisation der Betroffenen variierte deutlich und folglich auch die klinischen Krankheitsbilder. Es konnte lediglich eine Person nach kurzer Behandlung entlassen werden; zwei wurden in eine Rehabilitationseinrichtung verlegt und zwei verblieben zunächst auf der Intensivstation (Oxley et al., 2020). Diese Fallberichte unterstreichen die Relevanz therapeutischer Maßnahmen in einer noch berufstätigen Bevölkerungsgruppe, bei denen selbst subtile Defizite zu behandlungsbedürftigen Beeinträchtigungen der Lebensqualität und Arbeitsfähigkeit führen können.
Sonstige Mechanismen
Des Weiteren kann eine allgemeine Imbalance verschiedener physiologischer Systeme (z. B. durch Diarrhöe, Wassermangel und inflammatorische Reaktionen) zu einer akuten hirnorganischen Funktionsstörung beitragen. So sind Fieberkrämpfe und Bewusstseinsstörungen als Folge einer solchen Imbalance bekannt. Die Vulnerabilität, diese Gesundheitsstörungen zu entwickeln, ist im fortgeschrittenen Lebensalter erhöht. In den meisten Fällen sind die akuten Symptome transient, dennoch ist eine delirante Symptomatik oft ein Prädiktor einer reduzierten kognitiven Reserve (Gogol, 2008). Bei älteren Erkrankten können das Delir, aber auch die Hypogeusie (Schmeckstörung) und Hyposmie (Riechstörung) bis hin zur Ageusie (Geschmacksverlust) bzw. Anosmie (Ausfall des Geruchssinns) Anzeichen einer neurodegenerativen Erkrankung wie Morbus Parkinson oder Alzheimer-Demenz sein (Hüttenbrink, Hummel, Berg, Gasser & Hähner, 2013). Eine klare Abgrenzung zwischen durch SARS-CoV-2 ausgelösten Symptomen und vorbestehenden oder sich in der Prodromalphase befindenden neurologischen Erkrankungen mit neuropsychologischen Symptomen kann sich im Einzelfall als schwierig darstellen. Die klinisch-neuropsychologische Diagnostik kann durch Objektivierung und Profilvergleiche den diagnostischen Prozess maßgeblich unterstützen.
Spezielle neuropsychologische Funktionsstörungen
Da viele kognitive Defizite und Verhaltensänderungen durch eine immunologische Dysregulation vermittelt zu werden scheinen, sind symptomatische Ähnlichkeiten von Autoimmunerkrankungen, die mit neuropsychologischen Störungen einhergehen können, wahrscheinlich. Erkrankungen wie der systemische Lupus erythematodes (SLE), die Multiple Sklerose (MS), das neuroinvasive Human Immunodeficiency Virus (HIV), jedoch auch die Alzheimer- oder Parkinson-Erkrankung wurden mit einer immunologischen Über- oder Unterreaktion in Verbindung gebracht (Minagar et al., 2002). Beispielsweise sind bei der MS autoimmunologisch vermittelte neuropsychologische Veränderungen typisch (Grzegorski & Losy, 2017; Pust et al., 2019): So beschreiben bis zu 95 % der MS-Erkrankten eine Fatigue als beeinträchtigende Symptomatik. Defizite des Arbeitsgedächtnisses, des Gedächtnisabrufs und der visuo-konstruktiven Funktionen werden ebenfalls benannt (Calaprese & Penner, 2009; Pust et al., 2019). Darüber hinaus kann ein dauerhafter, inflammatorischer Prozess zu einer fortgesetzten Anregung der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse beitragen, was zahlreiche kognitive, affektive und neuropsychiatrische Störungen sowie nachteilige Wirkungen auf das Immunsystem erklären könnte (Chesnokova & Melmed, 2002; Iob, Kirschbaum & Steptoe, 2020).
Funktionelle Beschwerden, die möglicherweise mit dem beschriebenen Inflammationssyndrom bei COVID-19 assoziiert sein könnten, wurden pathophysiologisch mit Veränderungen des Hirnmetabolismus in ventralen Hirnregionen in Verbindung gebracht: So fanden Guedj et al. (2021) in einer 18F-FDG-PET-Studie bei 35 Betroffenen mit länger als 3 Wochen anhaltenden Beschwerden und ohne sonstige Hirnerkrankungen im Vergleich zu Kontrollpersonen einen Hypometabolismus in bilateral orbitofrontalen Regionen, um die Gyri olfactorii herum sowie im Bereich des rechten ventralen Temporallappens, einschließlich Amygdala und Hippocampus, sowie im Hirnstamm und Kleinhirn. Inwiefern auch spezielle Prozesse der krankheitsbezogenen Emotionsregulation zu diesem Muster beigetragen haben könnten, bleibt derzeit noch offen.
Pulmonale Erkrankungen wie das Akute respiratorische Syndrom können in schweren Fällen („hypoxische Enzephalopathie“; AWMF, 2021) mit zahlreichen neuropsychologischen Funktionsstörungen verbunden sein. Untersuchungen der Langzeitfolgen des ARDS zeigten, dass 1 Jahr nach Erkrankung bei einem Drittel der Betroffenen Beeinträchtigungen wie signifikante Leistungsminderungen in den Bereichen Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Exekutivfunktionen festgestellt werden konnten (Hopkins et al., 2006). Auch nach 2 Jahren lagen bei etwa der Hälfte der ARDS-Überlebenden weitere neuropsychologische Beeinträchtigungen und psychopathologische Symptome wie Depressionen und Angststörungen vor, welche deren Lebensqualität beeinträchtigten. Nur 34 % der Untersuchten dieser Stichprobe waren noch in Vollzeit beschäftigt (Hopkins et al., 2005). Einschränkend muss jedoch hinzugefügt werden, dass die anhaltenden Einschränkungen nach ARDS meist auch von einer allgemein verminderten Lebensqualität und emotionalen Beeinträchtigungen begleitet werden, die ebenfalls zu kognitiven Funktionsstörungen beitragen können. Eine Identifikation kausaler Zusammenhänge bleibt deshalb schwierig. Helms et al. (2020) untersuchten 58 Patientinnen und Patienten mit COVID-19 und intensivmedizinisch behandeltem ARDS, wobei die Magnetresonanzperfusionsbildgebung bei 19 % eine bilateral frontotemporale Hypoperfusion zeigte. Zum Zeitpunkt der Entlassung wurde bei 33 % der Betroffenen ein dysexekutives Syndrom (hier meist nur durch klinische Verhaltensbeobachtung erschlossene Störung der Aufmerksamkeit, Orientierung und Bewegungsausführung auf Anweisung) festgestellt. Diese Befunde entsprechen im Prinzip den vorgenannten Ergebnissen zum ARDS und Inflammationssyndrom.
Die intensivmedizinische Behandlung scheint im Hinblick auf langfristige Funktionsstörungen von großer Bedeutung zu sein. Persistierende oder fortschreitende physische Beeinträchtigungen wurden als Post-Intensive Care Syndrom (PICS) beschrieben: Dieses Syndrom kann nach einem intensivmedizinischen Krankenhausaufenthalt bis zu 15 Jahre lang anhalten und inkludiert Fatigue, Muskelschwäche, eine reduzierte Belastungstoleranz sowie pulmonale Einschränkungen (Biehl & Sese, 2020). PICS wurde bis heute nicht in die ICD-10 aufgenommen. Auf der affektiven Ebene sind Belastungssymptome, Angst und Depression häufig. Kognitiv stehen Konzentrationsschwierigkeiten und eine reduzierte Gedächtnisleistung im Vordergrund. Besonders vulnerabel im Hinblick auf PICS erscheinen Patientinnen und Patienten, die unter inflammatorischen und neurologischen Erkrankungen oder ARDS leiden. Behandlungsmerkmale, wie eine prolongierte Beatmung oder Einsatz von Sedativa, wurden mit einem erhöhten Risiko für PICS in Verbindung gebracht (Peach, Valenti & Sole, 2021). Zur Risikogruppe gehören insbesondere ältere Personen, Frauen, Erkrankte mit einer psychischen Vorbelastung sowie Angehörige ethnischer Minderheiten. Eine Metastudie zu dem Wiedererlangen der Erwerbsfähigkeit intensivmedizinisch Behandelter zeigte, dass nur 33 % der Behandelten nach 3 Monaten, 55 % nach 6 Monaten und 56 % nach 12 Monaten wieder berufstätig waren (McPeake et al., 2019). Hervorzuheben ist, dass sich verschiedene Risikofaktoren für PICS (z. B. hohes Alter, ARDS, Beatmung) mit den Risikofaktoren, Symptomen oder der Behandlung der COVID-19-Infektion überschneiden. Die Anzahl intensivmedizinisch behandelter Patientinnen und Patienten, die langfristig unter einem dem PICS entsprechenden Krankheitsbild leiden werden, könnte deshalb ansteigen. PICS ist keineswegs nur bei Erwachsenen zu beobachten. Eine niederländische Studie fand bei mehr als einem Drittel der pädiatrisch-intensivmedizinisch Behandelten eine poststationär langfristig erhöhte Belastung und bei über 15 % eine PTBS (Bronner, Knoester, Bos, Last & Grootenhuis, 2008).
Funktionsstörungen, die aus zerebrovaskulären coronavirusassoziierten Erkrankungen resultieren, sind äußerst vielfältig und hängen u. a. von der Lokalisation und Größe des jeweiligen Geschehens ab. Strategische Infarkte verursachen bekanntlich markante Symptome wie Aphasien oder Neglect, während multiple kleine Läsionen zu weniger spezifischen Defiziten führen (Lezak, Howieson, Loring & Fischer, 2004). Es ist gut bekannt, dass resultierende neurokognitive Defizite letztlich in ein demenzielles Syndrom übergehen können. Des Weiteren ist das Risiko einer Post-Stroke-Depression erhöht (Münte, 2009). Die Diagnostik und Behandlung entsprechender Funktionsstörungen ist ein traditionelles Aufgabenfeld der Klinischen Neuropsychologie.
Diese Effekte weisen insgesamt darauf hin, dass die speziellen kognitiven und emotionalen Funktionsstörungen und die individuellen neuronalen Schädigungsmechanismen integrierend bewertet werden sollten. Ein Müdigkeitssymptom und kognitive Beeinträchtigungen sind zwar nicht nur bei immunologischen Dysfunktionen, sondern auch bei Atemwegsinfektionen oder PICS wahrscheinlich (z. B. Larson, Weaver & Hopkins, 2007). Es ist jedoch eine wichtige Aufgabe der Neuropsychologie, die Besonderheiten der entsprechenden neurokognitiven Effekte herauszuarbeiten, vermittelnde Einflussfaktoren zu erkennen und diese Informationen differenzialdiagnostisch zu bewerten.
Forschungsprobleme
Viele der bisherigen Forschungsansätze weisen methodische Schwächen auf, welche die Interpretierbarkeit bezüglich der Verursachung der genannten (neuro)psychologischen Funktionsstörungen einschränken. Vor allem im chronischen Krankheitsstadium stellt sich die Frage, inwieweit diese Beeinträchtigungen kausal auf die COVID-19-Infektion bzw. auf assoziierte Erkrankungen und deren pathogenetische Mechanismen zurückzuführen sind. Die verfügbaren Reviews basieren zumeist auf Fall-, Gruppen- oder Metaanalysen, die jeweils spezifische Limitationen aufweisen: Fallstudien sind für den vorläufigen Forschungsstand typisch und dienen der elektiven Analyse und Deskription, jedoch werden methodische Standards (z. B. quasiexperimentelle Versuchspläne mit multiplen Untersuchungszeitpunkten und Kontrollbedingungen) meist nicht ausgeschöpft. Aussagen über funktionelle Auffälligkeiten resultieren sehr häufig aus Screeninguntersuchungen, Selbstberichten oder Anamnesegesprächen durch nicht einschlägig geschultes Personal. Randomisierte Gruppenstudien könnten manche Einschränkungen zwar überwinden, jedoch sind die Kontrollgruppen oft nicht äquivalent und prämorbide Daten zur Parallelisierung und Kontrolle fehlen. Insbesondere mangelt es an Vergleichsgruppen, die nicht erkrankt waren, aber ebenfalls unter den sozialen und wirtschaftlichen Einschränkungen der Pandemie (Kurzarbeit, Arbeitsplatzverlust, Isolation etc.) zu leiden hatten (z. B. Herridge et al., 2011). Um die chronischen Folgeerscheinungen der SARS-CoV-2-Erkrankung besser bewerten zu können, sollten die Einflüsse dieser sekundären Effekte (siehe Abbildung 2 für eine Übersicht) besser erfasst und in der statistischen Modellbildung berücksichtigt werden. Metaanalysen und Reviews sind derzeit noch selten. Allerdings bewerteten Rogers et al. (2020) die interne Validität der inkludierten Studien als mangelhaft bis moderat und verwiesen auf eine erschwerte Vergleichbarkeit aufgrund unterschiedlicher Messzeitpunkte, heterogener Gruppen und Qualität der neuropsychologischen Daten. Deshalb können derzeit nur Kovariationen zwischen COVID-19-assoziierten Erkrankungen und neuropsychologischen Beeinträchtigungen postuliert werden.
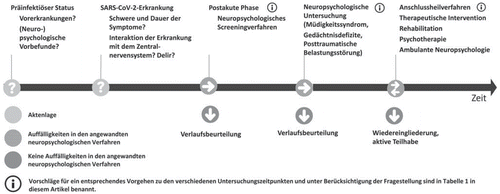
Implikationen für die neuropsychologische Diagnostik und Rehabilitation
Die oben zusammengefassten Befunde verdeutlichen, dass SARS-CoV-2 keine auf das internistische Fachgebiet beschränkte Erkrankung ist, sondern durch Schädigung verschiedener Organsysteme eine Vielzahl von neurokognitiven und affektiven Beeinträchtigungen hervorrufen kann. In der Folge der Pandemie rückt daher die Frage, wie die Erfassung, Behandlung und Rehabilitation von COVID-19-assoziierten neuropsychologischen Folgestörungen gestaltet werden kann, zunehmend in den Vordergrund. Aus Perspektive der Rehabilitationsforschung handelt es sich bei Indikationsentscheidungen zur Optimierung des Behandlungserfolgs stets um empirische Fragestellungen. Bei deren Beantwortung sind relevante Randbedingungen (z. B. Besonderheiten der biomedizinischen vs. [neuro]psychologischen Datenkategorien, intervenierende Variablen, Erfolgskriterien, Zeitpunkt der Untersuchung etc.) statistisch-methodisch angemessen zu berücksichtigen. Die Prozeduren der Einzelfalldiagnostik sind individuell zu optimieren (Schmitt & Gerstenberg, 2014), wobei das Ausmaß der Vulnerabilität für Hirnfunktionsstörungen und anderer für den Krankheitsverlauf wesentlicher Faktoren zu bedenken sind (siehe Abschnitt „Datenbereiche der Diagnostik“). Die nachfolgenden Vorüberlegungen zu möglichen neuropsychologischen Assessmentstrategien berücksichtigen relevante Aspekte der psychologischen Evaluationsforschung (z. B. Wittmann, Nübling & Schmidt, 2002; s. a. Peper, 2018); die Vorgehensweise muss im Hinblick auf die jeweils interessierenden, spezifischeren Zielsetzungen im Detail angepasst werden.
Beiträge, Aufgaben und Ziele des neuropsychologischen Assessments
Objektivierung der Art und Ausprägung von Funktionsbeeinträchtigungen
Beeinträchtigungen kognitiver, verhaltensbezogener, sozioemotionaler oder partizipativer Funktionen, die im Zusammenhang mit Coronaviruserkrankungen stehen, sollen unter Berücksichtigung einer bio-psycho-sozialen Perspektive (vgl. Borrell-Carrió, Suchman & Epstein, 2004) ermittelt und mit der präinfektiösen Situation der Betroffenen in Beziehung gesetzt werden. Um dies fundiert zu beurteilen, können individuelle Leistungsprofile ermittelt werden, um diese mit den Anforderungen prämorbider Aktivitäten zu vergleichen. Dies beinhaltet eine hypothesengeleitete Untersuchung unter Berücksichtigung der jeweiligen pathogenetischen Mechanismen. Besondere Aufmerksamkeit gebührt der Untersuchung der Ermüdbarkeit und Anstrengungsbereitschaft sowie den Gedächtnisfunktionen, der Aufmerksamkeit und den Exekutivfunktionen.
Spezifikation von Differenzialdiagnosen
Aufgabe der interdisziplinären Diagnostik ist es, eine Klassifikation möglicher erkrankungsbezogener Beeinträchtigungen vorzunehmen, sodass ein Störungsmodell als Begründung für spezifische Zielsetzungen der Rehabilitation erstellt werden kann. Unter Berücksichtigung der Pathophysiologie der Coronaviruserkrankung sind Beeinträchtigungen differenzialdiagnostisch abzuklären. Bei diesem Prozess ist der Einschluss neuropsychologischer Beiträge unabdingbar. Anhaltende oder progrediente Beeinträchtigungen der Hirnleistungen sind bezüglich prämorbider hirnorganischer Komorbiditäten (z. B. lakunäre Infarkte, präsymptomatisch neurodegenerative Erkrankungen etc.) zu differenzieren. Neben kognitiven Veränderungen sind insbesondere auch die organischen Persönlichkeitsveränderungen nach Inflammationssyndrom, psychoreaktive Faktoren (z. B. PTBS) sowie wechselseitig katalysierende Effekte (vgl. SEID) zu berücksichtigen. Dabei ist herauszuarbeiten, welche psychischen Störungen zu einer Verstärkung der Symptome beigetragen haben könnten (z. B. Depression, somatoforme Beeinträchtigungen ohne Hinweise auf eine organische Erkrankung etc.).
Behandlungsplanung und Verlaufskontrolle
Ein wichtiger Beitrag der Neuropsychologie besteht darin, bezüglich der ermittelten kognitiven und emotionalen Störungen einen Status zu erheben, einen Behandlungsplan zu erstellen sowie prognostische Einschätzungen im Hinblick auf die Kriterien des Rehabilitationserfolgs abzugeben. Idealerweise sollte gegen Ende der Akutphase ein neuropsychologisches Leistungsprofil erhoben werden, das einen Vergleichswert für Verlaufsuntersuchungen bietet und Empfehlungen für das weitere Heilverfahren ermöglicht. Im Verlauf des Rehabilitationsprozesses sollten die wesentlichen kognitiven und emotionalen Veränderungen nach Bedarf kompensatorisch oder restitutorisch behandelt werden. Die therapeutische Intervention muss kontinuierlich auf deren Wirksamkeit in Bezug auf die Rehabilitationsziele kontrolliert und ggf. angepasst werden. Abschließend sind fortbestehende Dysfunktionen lebenspraktischer Fähigkeiten zur Vorhersage langfristiger Einschränkungen im Alltag zu ermitteln und möglicherweise weitere Empfehlungen (z. B. ambulante neuropsychologische Therapien) auszusprechen.
Beurteilung rechtlicher Fragestellungen
Die Beiträge des neuropsychologischen Assessments werden in der Folgezeit der Coronapandemie auch deshalb an Bedeutung gewinnen, da sozial- und verwaltungsrechtliche Fragestellungen beantwortet werden müssen. Insbesondere ist die neuropsychologische Entscheidungs- und Urteilsbildung zur Beantwortung von Fragen des Sozial- und Arbeitsrechts (z. B. Schwerbehindertenrecht, Soziales Entschädigungsrecht, Minderung der Erwerbsfähigkeit), des Zivilrechts (z. B. private Berufsunfähigkeitsversicherung) sowie des Verwaltungsrechts (z. B. Dienstunfähigkeit, Geschäfts- und Einwilligungsfähigkeit) relevant. Hierbei können z. B. folgende gutachterliche Fragen beantwortet werden: Wie stark sind die krankheitsbedingten Beeinträchtigungen auf neuropsychologischem Fachgebiet ausgeprägt und wie wirken sich diese auf die verschiedenen Lebensbereiche aus? Haben kognitive Spätfolgen der Coronaviruserkrankung dazu beigetragen, dass die Fähigkeit der Berufsausübung oder des unabhängigen Lebens beeinträchtigt ist? Besonderes Augenmerk wird hierbei auf der Erschöpfungssymptomatik liegen, da diese die Arbeitstauglichkeit langfristig beeinträchtigen könnte (Tritt et al., 2004).
Datenbereiche der Diagnostik
Präinfektiöse Prädiktoren
Präinfektiöse, biomedizinische und psychologische (Baseline-)Daten ermöglichen eine Bewertung der Veränderungen nach Coronaviruserkrankungen. In vielen Fällen liegen jedoch kaum Vorinformationen vor. Die Interpretierbarkeit von Querschnittsstudien setzt jedoch eine Vergleichbarkeit des erhobenen mit dem präinfektiösen Status voraus. Grobe Einschätzungen des früheren Leistungsniveaus durch explorative Datenerhebungen oder Messungen der kristallinen Intelligenz können zwar Indikatoren liefern, sind statistisch jedoch nur begrenzt als Grundlage für Vergleiche tauglich (Binkau, 2016). Neben Informationen des prämorbiden neuropsychologischen Befindens sind auch Daten zu neurologischen und anderen Vorerkrankungen und -behandlungen zu berücksichtigen.
Postinfektiöse Kriteriumsvariablen
Nach Genesung oder Abschluss der Akutbehandlung können relevante Daten der involvierten Disziplinen als Kriteriumsvariablen verwendet werden. Beispielsweise können sich organphysiologische Funktionstests zur Prüfung einer fortbestehenden Hypoxie als sinnvoll erweisen. Mittels geeigneter Interviews und Fragebögen wird der neurologisch-psychiatrische Status ermittelt. Fortbestehende Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns sollten mittels Selbsteinschätzungsfragebögen und objektiven Tests untersucht werden (Cysique et al., 2021). Neuropsychologische Tests können der Generierung von kognitiven Leistungsindizes als Kriteriumsvariablen dienen (vgl. Tabelle 1).
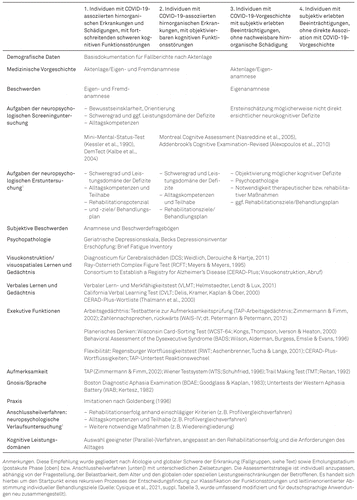
Experimentelle Behandlungsvariablen
Sollen kausale Wirkungen (z. B. einer speziellen medizinischen Behandlung, von medikamentösen Interventionen oder [neuro]psychologischen Therapiemaßnahmen etc.) evaluiert werden, werden diese unabhängigen Variablen dem Bereich der experimentellen Behandlungsvariablen zugeordnet.
Moderator- und Mediatorvariablen
Dieser Datenbereich inkludiert intervenierende biomedizinische und psychologische Merkmale, die experimentell nicht manipuliert werden. Moderatorvariablen beeinflussen den Zusammenhang zwischen der Coronaviruserkrankung und den Kriteriumsvariablen, während Mediatoren den Zusammenhang zwischen diesen Variablen herstellen. Zum Beispiel können sich komorbide Erkrankungen oder vorbestehende gesundheitliche Faktoren auf den Verlauf der Coronaviruserkrankung und deren Folgen auswirken. Mögliche Wechselwirkungen werden, wie oben zusammengefasst, insbesondere bei MS und vaskulären Erkrankungen vermutet (Zheng et al., 2020). Vorbestehende vaskuläre Erkrankungen können ein erhöhtes Infarktrisiko aufweisen (Pedicelli, Valente, Pilato, Distefano & Colosimo, 2020. Kognitive Beeinträchtigungen nach ARDS oder PICS werden v. a. bei älteren Betroffenen durch weitere Faktoren moderiert (z. B. Wessely, Hotopf & Sharpe, 1999; Wijeratne, Hickie & Brodaty, 2007): Dazu zählen nicht nur Schlafstörungen, mangelnde physische Aktivität und Schmerzsyndrome. Persönlichkeitseigenschaften und psychopathologische Bedingungen, sowie die damit verbundenen individuellen, kognitiven, emotionalen und motivationalen Reaktionsmuster sowie psychosoziale Stressoren können den Rehabilitationsverlauf beeinflussen. Psychologische Moderatoren (z. B. intellektuelles Leistungsniveau) und Mediatorvariablen (z. B. Merkmale der Krankheitsverarbeitung und der sozialen Unterstützung etc.) sollten abhängig von der Ausrichtung der Untersuchung ebenfalls berücksichtigt werden.
Kriteriumsvariablen der Auftraggeber
Im Datenbereich der Auftraggeber können Ergebnisse anhand der Erfolgskriterien des Behandlungs- und Rehabilitationsprozesses aus Sicht der Kostenträger, Versicherungen und anderer Interessengruppen operationalisiert werden: Dies inkludiert beispielsweise Merkmale der chronischen Behandlungsbedürftigkeit und der Partizipation am Arbeitsmarkt. Indizes des allgemeinen Wohlbefindens, der Lebensqualität und der psychischen Gesundheit u. Ä. werden häufig berücksichtigt.
Diagnostische Prozesse in den Rehabilitationsphasen
Allgemeine Empfehlungen
Mehrere interdisziplinär erstellte Leitlinien geben Empfehlungen zum diagnostischen und therapeutischen Vorgehen bei COVID-19. So verweist die S3-Leitlinie „Empfehlungen zur stationären Therapie von Patienten mit COVID-19“ der AWMF (2021) insbesondere bei persistierenden Beeinträchtigungen auf mögliche neurokognitive und emotionale Folgen und empfiehlt für die Rehabilitationsphasen eine psychologische Mitbetreuung bei psychischen Auffälligkeiten. Als Risikofaktor für spätere Langzeitkomplikationen wird das PICS-Syndrom benannt. Deshalb wird 8 bis 12 Wochen nach stationärer Behandlung eine Nachuntersuchung empfohlen. Auch die AWMF-S1-Leitlinie „Post-COVID/Long-COVID“ (Koczulla et al., 2021) soll die Diagnostik und Behandlung der Betroffenen erleichtern. An der entsprechenden Taskforce waren jedoch weder die Gesellschaft für Neuropsychologie e. V. (GNP) noch die Psychotherapeutenkammern beteiligt, sodass die fachlichen Begründungen der Empfehlungen im Umgang mit den entsprechenden Beeinträchtigungen diskussionswürdig erscheinen. Da der Einsatz neuropsychologischer Methoden bereits bei einer Vielzahl von Erkrankungen (z. B. entzündliche Erkrankungen des ZNS, Enzephalopathie, neurotoxische Exposition oder chronische Schmerzsyndrome etc.) empfohlen wurde, liegt eine Erweiterung entsprechender Empfehlungen auf COVID-19-assoziierte Störungsbilder nahe. Die letztgenannte Leitlinie umfasst Empfehlungen, welche sich primär auf die stationäre Phase A/B der Rehabilitation beziehen, während Empfehlungen für Diagnostik und Behandlung in späteren Phasen weiterhin ausstehen.
Neurologisch-psychiatrische Diagnostik
Im Kontext der klinisch-neurologischen Diagnostik (siehe ausführlich Koczulla et al., 2021) werden während der Rehabilitationsphasen A/B die pathogenetischen Mechanismen der Coronavirusfolgeerkrankungen differenzialdiagnostisch abgeklärt (AWMF, 2021). Insbesondere (a) unmittelbare hirnorganische Veränderungen aufgrund der Neuroinvasivität von Virusvarianten, (b) neuronale Veränderungen, die mit einem erhöhten immunregulatorischen Response in Beziehung stehen, (c) Veränderungen, die mit dem ARDS und hypoxischen Hirnschädigungen in Verbindung stehen, sowie (d) Folgen zerebrovaskulärer Erkrankungen werden hierbei berücksichtigt. Neben den direkten pathogenen Effekten der Viruserkrankung sind auch die beschriebenen indirekten Auswirkungen von Organschäden und iatrogenen Effekten diagnostisch bedeutsam (vgl. Abschnitt „Spezielle neuropsychologische Funktionsstörungen“, PICS; Dijkstra-Kersten et al., 2020; Kohler et al., 2019): Beispielsweise können neurokognitive und psychopathologische Symptome mit einer inkorrekten Medikamenteneinnahme und/oder einer polypharmakologischen Interaktion in Verbindung stehen, wobei Personen im höheren Lebensalter meist stärker betroffen sind (Schuler et al., 2008).
Neuropsychologische Diagnostik
Die Erfassung von subjektiven Beschwerden, kognitiven und verhaltensbezogenen Beeinträchtigungen oder Störungen steht im Dienst der Beantwortung der in Abschnitt „Coronavirusassoziierte Erkrankungen als Gegenstand der Neuropsychologie“ genannten Grundfragen. Je nach Ätiologie der Erkrankung, Schwere der Funktionsstörungen und dem Erholungszustand der Betroffenen können allerdings sehr unterschiedliche neuropsychologische Assessmentstrategien sinnvoll erscheinen. Selbsteinschätzungen relevanter Funktionsbeeinträchtigungen (z. B. wahrgenommene kognitive Defizite, Erschöpfung), Verhaltensbeobachtungsdaten (z. B. Fremdanamnese) sowie standardisierte Tests sind zur Abschätzung der Folgewirkungen wesentlich. Die Ad-hoc-Taskforce (Cysique et al., 2021) hatte zwar erste Empfehlungen für geeignete Methoden herausgearbeitet, jedoch sind diese nicht immer in deutschsprachigen Settings anwendbar. Die Empfehlungen müssten sich zudem an den unterschiedlichen Bedürfnissen von Subgruppen der Betroffenen orientieren. Des Weiteren stehen international eine Reihe computergestützter und automatisierter Testverfahren für die Domänen Aufmerksamkeit/Arbeitsgedächtnis, Exekutivfunktion, Motorik, Verarbeitungsgeschwindigkeit sowie Lernen und Gedächtnis zur Verfügung (Cysique et al., 2021), jedoch wird deren Wert durch sprachliche Barrieren und teilweise durch Probleme der Onlineselbstanwendungen beeinträchtigt, sodass hier auf die deutschsprachig normierten Verfahren zu verweisen ist. Ein entsprechend adaptierter Vorschlag findet sich in Tabelle 1, wobei der diagnostische Ansatz zunächst im deutschsprachigen Raum zielorientiert optimiert, standardisiert und evidenzbasiert abgesichert werden sollte.
In der akuten Krankheitsphase bestehen zunächst nur wenige Berührungspunkte zur neuropsychologischen Versorgung. Abhängig vom Schweregrad werden die meisten Erkrankte in Deutschland entweder gar nicht oder nur observatorisch hausärztlich behandelt. Etwa 10 % der Betroffenen werden in der ersten akuten Rehabilitationsphase A in Abteilungen der Inneren Medizin behandelt, von denen ca. 14 % beatmet werden (RKI, 2021d). Während der Rehabilitationsphase B stehen häufig globale Funktionsbeeinträchtigungen und der Bewusstseinszustand der Betroffenen im Vordergrund. So empfiehlt die AWMF-S1- Leitlinie „Post-COVID/Long-COVID“ (Koczulla et al., 2021) den Einsatz eines konkreten, kognitiven Screeninginstruments aus dem Kontext der Demenzdiagnostik: Montreal-Cognitive-Assessment (MoCA)-Test. Allerdings bestehen bekannte Nachteile dieser indexbasierten Verfahren in deren geringer Sensitivität aufgrund von Deckeneffekten und geringer Prädiktionskraft (Jahn, 2020) sowie in der fehlenden Validierung der Indexmaße für COVID-19-Erkrankte. Aufgrund erschwerender Bedingungen wie Durchführung am Krankenbett, Beatmungsgeräte und Schutzkleidung, Umgebungsgeräuschen sind entsprechende Screeningergebnisse meist wenig aussagekräftig. Für eine adäquate Beurteilung der Betroffenen ist ein hohes Maß an klinischer Erfahrung seitens der Untersuchenden erforderlich (Phillips et al., 2020). Werden Screenings unter nichtstandardisierten Rahmenbedingungen von nicht einschlägig ausgebildetem Personal durchgeführt, erhöht sich das Risiko, subtile neurokognitive Defizite bei leichter Betroffenen zu übersehen; es ist deshalb davon auszugehen, dass entsprechende Verfahren nur schwer betroffene Personen identifizieren. Wird eine nachfolgende, detaillierte neuropsychologische Diagnostik und Behandlung von einem solchen Indexwert abhängig gemacht (AWMF, 2021), kann sich die Gefahr falsch negativer Entscheidungen erhöhen. Alternativ ist eine evidenzbasierte, klassifikatorische Diagnostik unter Nutzung aller verfügbaren Datenquellen zwecks Optimierung der weiteren Behandlungsplanung sinnvoll.
Auch wenn ein systematisches, psychometrisches Assessment kognitiver und emotionaler Beeinträchtigungen zu einem Zeitpunkt, zu dem die Akutversorgung vordringlich ist, schwierig ist, sollten Personen mit einem erhöhten Risiko, neuropsychologische Folgestörungen zu entwickeln, frühzeitig erkannt werden. Falls Screeningverfahren für sinnvoll erachtet werden, sollten Items zu den Domänen Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Exekutivfunktionen und Müdigkeit enthalten sein; entsprechende Instrumente könnten z. B. unter Berücksichtigung der Ergebnisse der neuropsychologischen MS-Diagnostik für COVID-19-Genesene adaptiert werden (z. B. Calabrese, Kalbe & Kessler, 2004). Fällt das Ergebnis negativ aus, könnte der weitere Verlauf vorsorglich überwacht werden. Im positiven Fall würden die Betroffenen an einer ausführlicheren neuropsychologischen Untersuchung teilnehmen. Im Einzelfall bleibt es der Expertise der in der Frührehabilitation heilkundlich tätigen Behandelnden überlassen, zu erkennen, wann entsprechende Störungen offenkundig werden und weitere Untersuchungen bzw. neuropsychologische Behandlungen indiziert sind.
Dauern Beschwerden nach Coronaviruserkrankung länger als 6 Monate an oder ist eine neuropsychologische Störung wahrscheinlich, ist eine detaillierte Anamnese und Diagnostik sinnvoll. Ansatzpunkte, die einer Intervention oder Verlaufskontrolle bedürfen, sind in Abbildung 3 dargestellt. Hinweise auf kognitive und affektive Beeinträchtigungen werden sich in der Regel aus der Eigen- und Fremdanamnese ergeben. Generell sollten im Explorationsgespräch auf das Erleben der Erkrankung und die subjektiven Veränderungen im postmorbiden Verlauf eingegangen werden. Aufgrund der hohen Anzahl emotionaler Beeinträchtigungen sollte auch hinsichtlich einer Depression, PTBS und Angst- und Schmerzstörung exploriert werden. Des Weiteren sollte eine erweiterte Diagnostik zwecks Ausschlusses akuter Erkrankungen erfolgen (z. B. Alkohol- und Drogenkonsum, Ernährungsmängel, Immundefizienz, Nebenwirkungen von Medikamenteneinnahmen, neuropsychiatrische Erkrankungen etc.).
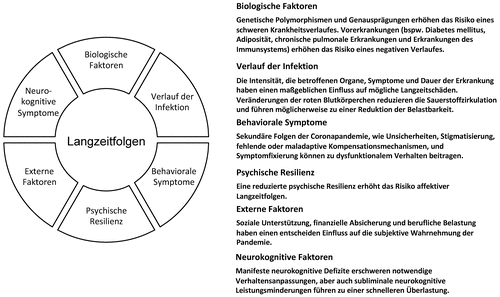
Im Übergang zur Rehabilitationsphase D rückt die Frage nach der Erfassung von Funktionsbeeinträchtigungen im Alltag und Berufsleben in den Vordergrund. Nach entsprechender differenzialdiagnostischer Abklärung könnten anhand neuropsychologischer Kriterien spezifische Behandlungsbedürfnisse für Untergruppen von Betroffenen spezifiziert und Empfehlungen für neuropsychologische Behandlungsziele ausgesprochen werden. Bei der Erfassung von Leistungsdefiziten kann zwar eine anhand internationaler Hinweise adaptierte Übersicht (Tabelle 1) Orientierungshilfen bieten, jedoch sollten in Deutschland die einschlägigen Leitlinien (z. B. Gedächtnis, exekutive Funktionen und Aufmerksamkeit; Gesellschaft für Neuropsychologie, 2021b) als maßgebend gelten. Für die Untersuchung COVID-19-Genesener haben Sozzi et al. (2020) folgende Domänen und Konstrukte empfohlen: kognitive Flexibilität, Problemlösen, Arbeitsgedächtnis, Lern- und Merkfähigkeit, Praxie sowie Aufmerksamkeitsleistungen. Da nach pulmonalen Erkrankungen gehäuft Gedächtnisdefizite beobachtet wurden (Riordan, Stika, Goldberg & Drzewiecki, 2020), sollte bei Verdacht einer hypoxischen Schädigung eine detailliertere Untersuchung der Gedächtnisfunktionen erfolgen. Ebenso sollte aufgrund der beobachteten präfrontalen Hypoperfusion bei ARDS-Genesenen (Helms et al., 2020) dysexekutive Funktionsstörungen überprüft werden. Das Assessment sollte dem intellektuellen Anforderungsprofil der Betroffenen entsprechen, hypothesengeleitet erfolgen und eine Einschätzung und Empfehlung möglicher Rehabilitationsmaßnahmen bei Auffälligkeiten ermöglichen. Je nach Erholungsphase gestalten sich auch bei COVID-19-Betroffenen die Behandlungsziele und damit auch die Anforderungen an das Assessment unterschiedlich, wobei Änderungen des Therapieziels im Dialog mit den Betroffenen entwickelt werden sollten (siehe dazu Hildebrandt [2021] in diesem Heft).
Im Übergang zur Phase E der schulisch-beruflichen Rehabilitation rücken mögliche Unterschiede in den Leistungsprofilen Genesener und den individuellen beruflichen Anforderungsprofilen (Kriteriumsmaße der Schul- und Arbeitsverwaltungen, Kostenträger etc.) in den Mittelpunkt. Das neuropsychologische Assessment kann hier im Rahmen von Verlaufsuntersuchungen mit Feedbackschleifen darauf hinwirken, Profilabweichungen zu identifizieren und Fehlentwicklungen zu vermeiden. Insbesondere kann sich die Wiedereingliederung in den Beruf aufgrund des Müdigkeitssyndroms schwierig gestalten. Da chronische Müdigkeit ein typisches Symptom vieler chronischer Krankheiten ist und auf zahlreiche biologische, psychische und soziale Ursachen zurückgeführt werden kann (AWMF, 2017), ist es allerdings unwahrscheinlich, dass diese Beschwerden ausschließlich als direkte Folge der Viruserkrankung erklärbar sind. Im Fall von COVID-19 dürfte Müdigkeit ebenfalls multifaktoriell bedingt sein. Die Diagnostik entsprechend AWMF-Leitlinie „Müdigkeit“ (AWMF, 2017) sieht eine Basisdokumentation mit Anamnese, klinischem Befund und Laboruntersuchungen vor. Bei Verdacht auf eine Fatigue würde ein leitliniengerechtes Assessment auch die Erfassung von Aufmerksamkeitsleistungen sowie Messwiederholungen der einfachen Reaktionszeit zum Anfang und Ende der Untersuchung enthalten, um Ermüdungsprozesse abzubilden (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften, 2011). Fragebögen, wie der „Fragebogen erlebter Defizite der Aufmerksamkeit“ (Zimmermann, Messner, Poser & Sedelmeier, 1991), können helfen, subjektive Beschwerden zu beschreiben. Neben der kognitiven Domäne der Fatigue können mittels Fragebögen auch die emotionale und körperliche Erschöpfung erfasst werden. Die Deutsche Fatigue Gesellschaft e. V. (2017) nennt für den deutschsprachigen Raum insbesondere das Multidimensional Fatigue Inventory (MFI; Smets, Garssen, de Bonke, de Haes, 1995) sowie den Fatigue Assessment Questionnaire (FAQ; Glaus, 1998) als Hilfsmittel zur Erfassung von Erschöpfungszuständen. Beide Fragebögen sind im onkologischen Bereich etabliert. Die Verhaltensbeobachtung ist ebenfalls von Bedeutung. Eine wichtige Aufgabe der neuropsychologischen Diagnostik ist es hierbei, prognostische Hilfsmittel zur Differenzierung günstiger und ungünstiger Verläufe unter Einbezug von Ergebnissen der Arbeitstherapie und Belastungserprobung bereitzustellen.
Klinisch-psychologische Diagnostik
Zur Sicherstellung einer hochwertigen Behandlung während aller Phasen der Rehabilitation sollte auch eine differenzierte Auseinandersetzung mit den kognitiven, emotionalen und sozialen Folgen der Erkrankung gefördert werden. Abhängig von den jeweiligen Fragestellungen ist zu klären, welche emotionalen und sozialen Belastungen aus dem Krankheitsgeschehen resultieren. Haben sich im Krankheitsverlauf Veränderungen in der Wahrnehmung von Körperprozessen und im Bewältigungsverhalten (Sensibilisierung, Rückzug und Berufsaufgabe, soziale Isolation etc.) ergeben? Liegt eine Körperliche Belastungsstörung vor? Präinfektiöse Faktoren wie eine reduzierte Resilienz und/oder mangelnde kognitive Reserve sind in Bezug auf das Fortbestehen von psychischen Folgeproblemen zu berücksichtigen. Allgemeine psychische Beeinträchtigungen sind insbesondere im Zusammenhang mit einer PTBS abzuklären, wobei 6 bis 9 Monate als geeigneter Zeitraum einer Verlaufsuntersuchung angesehen wurden, da dies der Erstmanifestation von Symptomen entspricht (Benoy, 2021).
Therapiezielorientierte Klassifikation
Die eingangs genannten Klassifikationsvorschläge der ICD einschließlich der Post-COVID-19- und Müdigkeits-Syndrome bilden häufige Symptomkonstellationen und deren Schweregrad ab. Sie erscheinen im Kontext der Rehabilitation jedoch weniger hilfreich, da sie die Ursachen des komplexen Krankheitsgeschehens und der individuellen Funktionsstörungen nicht hinreichend berücksichtigen. Im Hinblick auf die Behandlungsziele der Rehabilitation ist die Erfassung von Funktionsstörungen (International Classification of Functioning, Disability and Health, [ICF]) auf neuropsychologischem Gebiet wesentlich. Darüber hinaus ist eine therapiezielorientierte Optimierung der klassifikatorischen Diagnostik wünschenswert, welche die neuropathologischen Mechanismen der Störung mitberücksichtigt (vgl. RDoC; Sharp et al., 2016)
Da die Störungen bezüglich Dauer, Ätiologie und Schweregrad sehr heterogen und die Bandbreite möglicher Maßnahmen groß sind, erscheint es sinnvoll, evidenzbasiert Fallgruppen zu entwickeln, um qualitativ und quantitativ unterschiedlich stark betroffene Individuen verschiedenen Behandlungsplänen zuweisen zu können. Dabei erscheint es sinnvoll, in Anlehnung an die Klassifikation anderer chronisch adverser Zustände (vgl. Peper et al., 2006) die Dauer, das Ausmaß und die vermutete Reversibilität der neurokognitiven Symptomatik zu berücksichtigen. Auch wenn initiale, therapiezielorientierte Klassifikationsversuche evaluiert und evidenzbasiert optimiert werden können, erscheint im Einzelfall und im weiteren Verlauf eine dynamische Anpassung und dialogische Entwicklung der neuropsychologischen Behandlungsziele sinnvoll (siehe dazu Hildebrandt [2021] in diesem Heft).
(1) Individuen mit fortschreitendem und globalem intellektuellem und sozialem Funktionsverlust, nachweisbaren neurostrukturellen Veränderungen sowie zahlreichen neuropsychologischen Defiziten könnten einer ersten Fallgruppe zugewiesen werden, bei der die Erhaltung der kognitiven Leistungsfähigkeit, Selbstständigkeit, aktiven Teilhabe sowie die Förderung noch vorhandener Ressourcen wichtige Ziele sind. (2) Betroffene nach prolongierter Krankheitsvorgeschichte mit neuropsychologischen Störungen, welche mit der Art, der Dauer, und dem Schweregrad einer vorliegenden, hirnorganischen Schädigung assoziiert sind, könnten einer zweiten Gruppe zugeordnet werden. Die Therapieziele könnten sich in diesem Fall an den objektivierbaren Beeinträchtigungen in den Domänen Gedächtnis und Aufmerksamkeit, Exekutivfunktionen sowie Emotionen orientieren (Sozzi et al., 2020), wobei die Diagnostik und Behandlung in Präsenz erfolgen sollte. (3) Einer dritten Gruppe könnten Personen zugeordnet werden, die zwar eine entsprechende Vorgeschichte aufweisen, deren Leistungsdefizite aber nicht objektiviert werden können bzw. deren Beeinträchtigung im Erleben kognitiver, motivationaler und emotionaler Schwierigkeiten besteht, wobei eine Reversibilität dieser Beschwerden anzunehmen ist. Unter Beachtung der Bedürfnisse und Ressourcen sind bei dieser Gruppe ggf. auch teletherapeutische Übungen einsetzbar. (4) Personen, deren Krankheitsgeschichte keine direkte Assoziation mit einer Corornavirusfolgeerkrankung aufweist und die keine kognitiven Defizite zeigen, könnten einer vierten Gruppe zugeordnet werden. Die erlebten Beeinträchtigungen wie Müdigkeit, Reizbarkeit, Depression und Angst wären in diesem Fall differenzialdiagnostisch genauer zu spezifizieren, um ggf. geeignete psychotherapeutische Interventionen begründen zu können.
Neuropsychologische Rehabilitationsbehandlung
Rehabilitationsbehandlungen nach Coronaviruserkrankungen gehen im Allgemeinen über die Lungenschädigung hinaus und beziehen auch organspezifische, extrapulmonale Schädigungen mit ein (z. B. Reinhard et al., 2021). Der Wiederherstellung möglicher Hirnfunktionsstörungen sollte hierbei eine hohe Priorität eingeräumt werden, da dies zweifellos für eine gelingende Wiedereingliederung der Genesenden in das berufliche und gesellschaftliche Leben wesentlich ist. Beschränkten sich die Rehabilitationsbemühungen auf die Erholung peripherer Organfunktionen, könnten Behandlungsnotwendigkeiten im Bereich moderierender neuropsychologischer Funktionen (z. B. eine reduzierte Aktivierbarkeit) und mediierender Mechanismen (z. B. durch ventromedial-präfrontale Hypoperfusion verminderte flexible Anpassung der Handlungskontrolle) unerkannt bleiben. Die Effektivität von Maßnahmen könnte demgemäß verbessert werden, wenn entsprechende Folgen rechtzeitig erkannt würden (siehe Abbildung 3 für mögliche Ansatzpunkte der neuropsychologischen Rehabilitation).
Maßnahmen der rehabilitativen Förderung der kognitiven und emotionalen Ressourcen könnten in der Anwendung neuropsychologischer Therapien sowie psychoedukativer Ansätze bestehen. Die Aufklärung über mögliche subtile neuropsychologische Defizite könnte Überlastungen reduzieren, reaktive emotionale Veränderungen vermeiden (Beblo & Lautenbacher, 2006) und die Handlungsbereitschaft der Betroffenen erhöhen. Ein Training der Aufmerksamkeitsfunktionen könnte zu einer Milderung der Müdigkeitssymptomatik beitragen (Hauke, Fimm & Sturm, 2011). Vergleichsstudien mit unterschiedlichen Interventionsverfahren und Kombinationen werden benötigt, um adäquate Behandlungsansätze identifizieren zu können (vgl. Caplain, Chenuc, Blancho, Marque & Aghakhani, 2019).
Während der Pandemie wurde professionelle Hilfe vergleichsweise wenig konsultiert, da offenbar Bedenken bezüglich einer möglichen Ansteckung während der persönlichen Interaktion bestanden (Rosenberg Danziger et al., 2021). Seit dem 01.04 2019 sind psychologische Unterstützung und neuropsychologische Diagnostik auch in digitaler Form möglich. Basierend auf einer Befragung der Psychotherapeutenkammer im Jahr 2020 schätzen allerdings 59 % der Befragten eine digitale Behandlung als weniger wirksam ein (Eichenberg, 2021). Erste Erfahrungen verdeutlichen jedoch auch, dass eine „Rehabilitation auf Distanz“ durch digitale Vermittlung möglich und effektiv sein kann (vgl. Reinhard, 2020). Diese neuen Möglichkeiten sollten daher auch für den Bereich der Neurorehabilitation einschließlich der neuropsychologischen Behandlung angepasst werden (Frommelt & Lösslein, 2010; siehe auch Abschnitt „Perspektiven“).
Die neuropsychologischen Rehabilitationsansätze sollten nicht nur neurokognitive Therapien inkludieren: Die Pandemie wurde als multidimensionaler negativer Stressfaktor beschrieben (Gruber et al., 2020), der u. a. aufgrund der geringen Vorhersagbarkeit bezüglich Dauer und Verbreitung, Beeinträchtigung der persönlichen Lebensführung und Unsicherheiten hinsichtlich der Unterstützungs- und Schutzmöglichkeiten markante Effekte auf die psychische Gesundheit ausüben kann (Übersicht siehe Brakemeier et al., 2020). Viruserkrankungen mit einer hohen Letalität stellen ein kritisches Lebensereignis mit erheblich beanspruchender Wirkung auf das Individuum dar. Das rudimentäre Wissen zur Virulenz und zu den Folgen von SARS-CoV-2-Infektionen kann bei vielen Betroffenen Ängste und Unsicherheiten hervorrufen. Auch Quarantänemaßnahmen und die damit verbundene Reduktion persönlicher sozialer Unterstützung können Beanspruchungseffekte verstärken. Erschwerend können Einschränkungen des selbstbestimmten Handelns, das Fehlen von Kompensationsmechanismen sowie eine mögliche Stigmatisierung erkrankter Personen hinzutreten (vgl. Benoy, 2021). Liegt eine reduzierte Resilienz vor, ist das Entstehen, die Persistenz oder die Verschlimmerung psychischer Störungen nicht unwahrscheinlich. Bezüglich psychischer Belastungen scheint das Gesundheitspersonal eine besonders gefährdete Risikogruppe zu sein. Noch 1 bis 2 Jahre nach einer Coronaviruspandemie konnten bei erkranktem Personal, dessen emotionale Beanspruchung während der Pandemie erhöht war, anhaltende psychische Beeinträchtigungen festgestellt werden (Lam et al., 2009). Häufig schienen Phobien und Zwänge aufzutreten, z. B. sind Waschzwänge und zwanghafte Isolation aufgrund von Ansteckungsängsten möglich.
Im Vergleich zu anderen Krankheitsbildern mit unterschiedlichem Schweregrad erscheint die Häufigkeit affektiver Reaktionen und psychischer Störungen bei Coronaviruserkrankungen erhöht. Taquet, Luciano, Geddes und Harrison (2021) untersuchten eine große Stichprobe COVID-19-Betroffener anhand digitaler Aktenaufzeichnungen und schlussfolgerten, dass psychische Störungen bei den Betroffenen häufiger diagnostiziert wurden und dass diese sogar umgekehrt als unabhängiger Risikofaktor für COVID-19 angesehen werden könnten. Die Konfundierung durch andere Risikofaktoren für COVID-19 und den Schweregrad der Erkrankungen wurde durch Propensity-Scores kontrolliert, jedoch könnte dies auch zu einer Verzerrung der Auswertung geführt haben. Eine höhere Zahl psychischer Störungen nach COVID-19 im Vergleich zu anderen Erkrankungen könnte nicht nur Folge der Isolation oder speziellen Medikamentenbehandlungen sein; v. a. bei schwer Erkrankten sind mögliche hirnorganische Mechanismen der gestörten Emotionalität mit zu bedenken.
Prädiktion und Prävention
Wie die Risikofaktoren eines schweren akuten Krankheitsverlaufs mit dem Risiko neuropsychologischer Langzeitbeeinträchtigung zusammenhängen, bleibt zurzeit noch offen. Es ist deshalb eine wichtige Aufgabe der Forschung, Prädiktoren zu ermitteln, welche es erlauben, Patientinnen und Patienten zu identifizieren, die ein erhöhtes Risiko aufweisen, Langzeitfolgen zu entwickeln. Unabhängig von der Coronaviruserkrankung hat die Forschung zu neurologischen Krankheitsbildern mit funktionsübergreifenden und unspezifischen kognitiven, behavioralen und emotionalen Folgen gezeigt, dass prognostische Hilfsmittel zur Differenzierung günstiger und ungünstiger Verläufe hilfreich sein können. So weist z. B. die Studie von Caplain, Blancho, Marque, Montreuil und Aghakhani (2017) darauf hin, dass bei Patientinnen und Patienten mit Schädelhirntrauma eine distinkte Konstellation subjektiver Beschwerden, medizintechnischer Befunde und neuropsychologischer Ergebnisse einen erhöhten prädiktiven Nutzen bezüglich auftretender somatischer, kognitiver und emotionaler Folgebeschwerden besitzen kann. Auf diese Weise können Indexvariablen erzeugt werden, welche nach erfolgreicher Validierung Hinweise darauf erbringen können, welche Personen einer neuropsychologischen Behandlung oder/und einer anderen Form der Psychotherapie zugewiesen werden sollten. Entsprechende Ansätze zur Prädiktion und Prävention ungünstiger Verläufe nach Coronaviruserkrankungen stehen allerdings noch aus.
Zusammenfassung und Perspektiven
Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit war zunächst auf die epidemiologischen Endpunkte der Inzidenz und Letalität bzw. Intensivstationsauslastung durch Coronaviruserkrankte gerichtet. Zunehmend interessieren jedoch die langfristigen „weichen“ Krankheitsfolgen, insbesondere auf dem Gebiet der psychischen Störungen (z. B. Brakemeier et al., 2020). Während im Akutstadium der COVID-19-Erkrankung meist direkte pathogenetische Effekte der viralen Aktivität und der immunologischen Response (antikörperassoziierte hirnorganische Symptome) die neuropsychologischen Störungsbilder beeinflussen, werden langfristige neurokognitive Folgeprobleme meist als Ergebnis eines multifaktoriellen Geschehens gesehen, welches mit einer Vielzahl prämorbider, biomedizinischer, iatrogener, somatischer und psychischer Einflussgrößen und deren Wechselwirkungen in Verbindung steht. Abbildung 3 fasst diese im Rahmen eines bio-psycho-sozialen Modells interessierenden Einflussfaktoren zusammen.
Die Ergebnisse zu coronavirusassoziierten Krankheiten oder Funktionsstörungen des ZNS verdeutlichen, dass Genesene langfristig das Erscheinungsbild eines Post-COVID-Syndroms entwickeln können, welches v. a. durch reduzierte Belastbarkeit und Müdigkeit, Kopfschmerzen, Aufmerksamkeitsstörungen sowie Gedächtnisprobleme gekennzeichnet ist (Lopez-Leon et al., 2021). Die Gruppe der Genesenen zeichnet sich durch eine große Heterogenität nicht nur in Bezug auf soziodemografische und präinfektionale Merkmale aus, sondern weist eine unterschiedliche Qualität und Quantität der Störungen, pathophysiologischen Ursachen und postakuten Verläufe auf.
Viele der vorgeschlagenen symptom- und diagnosebezogenen Klassifikationsversuche beruhen auf klinischen Beobachtungen und Selbstberichten. Möglicherweise beantworten diese Ansätze die Fragen nach möglichen Gründen, Verläufen und Erfolgsaussichten von Rehabilitationsbehandlungen nicht vollständig. Die Bewertung der COVID-19-Folgestörungen könnte möglicherweise verbessert werden, indem die Vorschläge, welche aus dem RDoC hervorgegangenen sind, auch im Bereich der COVID-19-Folgeerkrankungen berücksichtigt würden: Statt deskriptiver Kategorisierungen sollte die Konzeptbildung auf Grundlage verhaltensneurowissenschaftlicher Konstrukte erfolgen (Sharp et al., 2016). Biomedizinische und psychische Gesundheitseffekte sollen laut RDoC im selben Bezugssystem abgebildet werden. In diesem Zusammenhang könnte die neuropsychologische Diagnostik dazu beitragen, relevante Merkmale zu identifizieren, um Untergruppen von Betroffenen evidenzbasiert zu definieren, Krankheitsverläufe und Behandlungsergebnisse vorherzusagen und therapiezielorientierte Entscheidungshilfen in Hinblick auf die Planung personalisierter, neurorehabilitativer Behandlungen bereitzustellen.
Perspektiven
Aus diesen Überlegungen ergeben sich zahlreiche Ansatzpunkte für die zukünftige Forschung:
- 1Aus dem methodischen Repertoire des neuropsychologischen Assessments sollten Methoden so zusammengestellt werden, dass coronavirusassoziierte kognitive Störungen (z. B. der Aufmerksamkeit, der Exekutivfunktionen, des Gedächtnisses sowie der kognitiven Müdigkeit und Anstrengungsbereitschaft etc.) standardisiert an größeren Stichproben Betroffener erfasst werden können. Zu diesem Zweck sollten neue Erhebungstechnologien (Testbatterien und Fragebögen) zusammengestellt bzw. angepasst werden. Die jeweilige Assessmentstrategie sollte mit internationalen Empfehlungen (z. B. Cysique et al., 2021) harmonisiert werden.
- 2Modellanpassungen biomedizinischer, neuropsychologischer und weiterer psychometrischer Daten zur verbesserten Identifikation und Vorhersage potenzieller Spätfolgen (z. B. Anpassung latenter Variablenmodelle unter Berücksichtigung neuropathologischer Informationen).
- 3Evidenzbasierte Kalibrierung von Assessmentprozeduren zwecks Abbildung coronavirusspezifischer Veränderungen (zum Zweck einer therapiezieloptimierten Bildung von Untergruppen) sowie adaptive Verlaufskontrolle zur Prädiktion von Spätfolgen etc.). Neben Zuverlässigkeit und Gültigkeit sollte der zusätzliche Entscheidungsnutzen dieser Diagnostik im Kontext empirisch-kontrollierter Bewährungsstudien im Hinblick auf die Erfolgskriterien der Rehabilitation überprüft werden.
- 4Neuropsychologische Behandlungsansätze setzen eine entsprechende entscheidungstheoretisch-klassifikatorische Modellbildung und Prozesstheorie voraus. Der Entscheidungsnutzen neuropsychologischer Merkmale ist im Hinblick auf die Indikation der Maßnahmen aufzuklären. Empirisch-kontrollierte Untersuchungen der indizierenden Entscheidungsprozesse setzen eine umfassende Kriterienanalyse (z. B. Erwerbsfähigkeit und Gesundheitsverhalten etc.) voraus.
Im Kontext der Coronapandemie hat in den USA die Häufigkeit der Anfragen bezüglich neuropsychologischer Diagnostik und Therapie zugenommen und eine weitere Zunahme ist wahrscheinlich (Sozzi et al., 2020). Eine grundsätzlich unterschiedliche Entwicklung ist für Deutschland kaum zu erwarten. Die Langzeitfolgen können deshalb zu einer weiteren Eskalation der neuropsychologischen Unterversorgung in Deutschland beitragen. Laut Daten der GNP standen 210 kassenärztlich zugelassene Neuropsychologinnen und Neuropsychologen einem Bedarf von ca. 1100 Fachkräften gegenüber (GNP, 2021a). Es bedürfen jedoch ca. 40 000 bis 60 000 Betroffene einer neuropsychologischen Behandlung. Auch wenn das stationäre neuropsychologische Versorgungspotential günstiger eingeschätzt werden kann, wird der durch die Pandemie entstehende Zusatzbedarf vermutlich nicht gedeckt.
Die Kontaktbeschränkungen im Kontext der Pandemie stellten für die Gesellschaft in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung dar, jedoch konnten im Bereich der neuropsychologischen Beratung und Behandlung auch neue Möglichkeiten geschaffen werden. Nach dem Beispiel der Telemedizin ist es heute möglich, teleinterventionell vorzugehen und in Teilgebieten eine kontaktlose neuropsychologische Anbindung zu ermöglichen. Natürlich bleiben Bedenken bezüglich der offenkundigen Nachteile von Onlineassessments bestehen (z. B. Einschränkungen der klinischen Verhaltensbeobachtung, erschwerter Einsatz standardisierter Testverfahren oder von Verfahren mit Gebrauchsgegenständen). Zwar können Paper-Pencil-Verfahren auch vor Untersuchungen zugesandt werden, jedoch könnte dies die Ergebnisse verfälschen. Gleichwohl erlaubt der teleinterventionell-rehabilitative Bereich auch auf dem Gebiet der Neuropsychologie eine größere Bandbreite an Beratungs- und Behandlungsformaten. Über die Pandemie hinaus kann die Nutzung digitaler Medien als Chance gesehen werden, insbesondere auch die ländlichen Regionen ohne Zugang zu einer neuropsychologischen Versorgung besser einzubinden. Voraussetzung dafür ist die Anpassung technischer Instrumente, eine ausreichende Netzverbindung und die Schulung grundlegender technischer Fähigkeiten der zu Behandelnden. Betroffene mit der höchsten Vulnerabilität (hohes Alter) erfüllen diese Voraussetzungen oftmals nicht. Die Umsetzbarkeit einer standardisierten neuropsychologischen Diagnostik in einer Zeit zunehmender Onlineassessments muss daher auch kritisch beurteilt werden.
Schlussfolgerungen
Die Coronapandemie mit ihren Nachwirkungen auf die körperlich-psychische Gesundheit hat erneut konkurrierende Pathogenesekonzepte, Diagnosestrategien und Therapiekonzepte der beteiligten Fachgebiete vor Augen geführt. Das neuropsychologische Assessment ergänzt in diesem Geschehen wesentliche Informationen, welche in der ärztlichen Routine in der Regel nicht erhoben werden; es bildet wichtige Aspekte des Rehabilitationserfolges oder intervenierender Prozesse ab, die auch für die Auswahl und Zuordnung von Behandlungsmaßnahmen wesentlich sind. Es werden künftig empirisch gesicherte Konzepte und Modelle benötigt, um bei Personen mit überdurchschnittlich langer Dauer kognitiver Beeinträchtigungen eine kriterienorientierte Indikation entwickeln zu können. Rehabilitationserfolge bei Genesenen könnten verbessert werden, wenn fortbestehende neuropsychologische Störungen mittels geeigneter Differenzialdiagnostik besser erkannt würden und wenn die Betroffenen initial empirisch begründet unterschiedlichen Maßnahmen zugewiesen werden könnten. Dazu werden angemessen operationalisierte, neuropsychologische Prädiktionsmodelle benötigt, welche im Hinblick auf die einschlägigen Kriterien des Rehabilitationserfolgs zu evaluieren sind. Im Kontext der Neuro-Corona-Forschung kann sich die Neuropsychologie als eine wichtige integrierende Disziplin erweisen, da sie die verursachenden, pathophysiologischen Phänomene der cororonavirusassoziierten Erkrankungen mit den neurowissenschaftlichen Grundlagen von Kognition, Emotion und Motivation zusammenführt.
Literatur
(2020). Comparative review of SARS-CoV-2, SARS-CoV, MERS-CoV, and Influenza A respiratory viruses. Frontiers in Immunology, 11, 2309. https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.552909
(2021). Prevalence and clinical outcomes of COVID-19 in patients with autoimmune diseases: A systematic review and meta-analysis. Annals of the Rheumatic Diseases, 80, 384. https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-218946
(2010). Validation of the German revised Addenbrooke’s cognitive examination for detecting mild cognitive impairment, mild dementia in Alzheimer’s disease and frontotemporal lobar degeneration. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 29, 448–456.
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften [AWMF] e. V. (2011). S2e-Leitlinie Diagnostik und Therapie von Aufmerksamkeitsstörungen bei neurologischen Erkrankungen. AWMF-Register-Nr. 030–135. Verfügbar unter https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/030-135.htmlArbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften [AWMF] e. V. (2017). S3-Leitlinie Müdigkeit. AWMFRegister-Nr. 053–002. Verfügbar unter https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/053-002.htmlArbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften [AWMF] e. V. (2021). S3-Leitlinie Empfehlungen zur stationären Therapie von Patienten mit COVID-19. AWMF-Register-Nr. 113–001. Verfügbar unter https://www.awmf.orgleitlinien/detail/ll/113-001LG.html(2001). Regensburger Wortflüssigkeits-Test – RWT. Göttingen: Hogrefe.
(2020). COVID-19 presenting as stroke. Brain, Behavior, and Immunity, 87, 115–119.
(2006). Neuropsychologie der Depression. Fortschritte der Neuropsychologie. Göttingen: Hogrefe.
(2021). Assessment of cognitive function in patients after COVID-19 infection. JAMA network open, 4 (10), e2130645. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.30645
). (2021). COVID-19: Ein Virus nimmt Einfluss auf unsere Psyche. Psychologische Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der einhergehenden Maßnahmen – ein Überblick (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
(2020). Post-intensive care syndrome and COVID-19: Implications post pandemic. Cleveland Clinic Journal of Medicine, 87. https://doi.org/10.3949/ccjm.87a.ccc055
(2016). Ist der Mehrfachwahl-Wortschatz-Test Version A (MWT-A) zur Schätzung des prämorbiden Intelligenzniveaus geeignet? Überprüfung an einer konsekutiven Stichprobe einer Demenz-Spezialambulanz. Dissertation Universität Leipzig.
(2021). Neuropsychologische Störungen und Symptome einer somatischen Belastungsstörung als Langzeitfolgen nach einer COVID-19 Infektion. Zeitschrift für Neuropsychologie, 32 (4), 223–228.
(2016). The risk of new onset depression in association with influenza: A population-based observational study. Brain, Behavior, and Immunity, 53, 131–137. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2015.12.005
(2004). The biopsychosocial model 25 years later: Principles, practice, and scientific inquiry. Annals of Family Medicine, 2, 576–582. https://doi.org/10.1370/afm.245
(2020). Die COVID-19-Pandemie als Herausforderung für die psychische Gesundheit. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 49, 1–31.
(2008). Posttraumatic stress disorder (PTSD) in children after paediatric intensive care treatment compared to children who survived a major fire disaster. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 2, 9. https://doi.org/10.1186/1753-2000-2-9
(2021). N-methyl-d-aspartate receptor encephalitis associated with COVID-19 infection in a toddler. Pediatric Neurology, 114, 75.
(2004). Ein neuropsychologisches Screening zur Erfassung kognitiver Störungen bei MS-Patienten: Das Multiple Sklerose Inventarium Cognition. Psychoneuro, 30, 384–388.
(2009).
Neuropsychologische Defizite nach entzündlichen Erkrankungen . In W. Sturm, M. Herrmann & T. Münte (Hrsg.), Lehrbuch der Klinischen Neuropsychologie (2. Aufl., S. 672–688). Heidelberg: Springer Spektrum.(2017). Early detection of poor outcome after mild Traumatic Brain Injury: Predictive factors using a multidimensional approach – a pilot Study. Frontiers in Neurology, 8, 666. https://doi.org/10.3389/fneur.2017.00666
(2019). Efficacy of psychoeducation and cognitive rehabilitation after mild Traumatic Brain Injury for preventing post-concussional syndrome in individuals with high risk of poor prognosis: A randomized clinical trial. Frontiers in Neurology, 10, 929. https://doi.org/10.3389/fneur.2019.00929
(2020). Persistent symptoms in patients after acute COVID-19. Journal of the American Medical Association, 324, 603–605.
(2002). Neuro-immuno-endocrine modulation of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis by gp130 signaling molecules. Endocrinology, 143, 1571–1574. https://doi.org/10.1210/endo.143.5.8861
(2015). Beyond myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: An IOM report on redefining an illness. Journal of the American Medical Association, 313, 1101–1102.
(2021). Assessment of neurocognitive functions, olfaction, taste, mental, and psychosocial health in COVID-19 in adults: Recommendations for harmonization of research and implications for clinical practice. Journal of the International Neuropsychological Society, 2021, 1–19 (Epub ahead of print). https://doi.org/10.1017/S1355617721000862
(2020). Genetic gateways to COVID-19 infection: Implications for risk, severity, and outcomes. FASEB Journal, 34, 8787–8795. https://doi.org/10.1096/fj.202001115R
(2018). Long-term neuropsychological outcome following pediatric anti-NMDAR encephalitis. Neurology, 90, e1997–e2005.
(2020). Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and the central nervous system. Trends in Neurosciences, 43, 355–357. https://doi.org/10.1016/j.tins.2020.04.004
(2000). California Verbal Learning Test (2nd ed.). San Antonio, TX: Psychological Corporation.
Deutsche Fatigue Gesellschaft e. V. (2017). Fatigue Therapiemanual. Verfügbar unter https://deutsche-fatigue-gesellschaft.de/wpcontent/uploads/2017/10/LO_therapie_manual_Ansicht.pdf(2020). Neuropsychiatric outcome in subgroups of Intensive care unit survivors: Implications for after-care. Journal of Critical Care, 55, 171–176. https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2019.11.006
(2010). Cognitive function in COPD. European Respiratory Journal, 35, 913–922. https://doi.org/10.1183/09031936.00125109
(2021). Onlinepsychotherapie in Zeiten der Coronapandemie. Psychotherapeut, 1–8. https://doi.org/10.1007/s00278-020-00484-0
(2016). Structural brain changes in patients With COPD. Chest, 149, 426–434. https://doi.org/10.1378/chest.15-0027
(2020). Welche Rolle spielt ein mögliches Hyperinflammationssyndrom bei einer schweren COVID-19-Infektion und können hieraus Konsequenzen für die Therapie gezogen werden? doi:https://doi.org/10.25646/7037
(2021). COVID-19 and neurological disorders: Are neurodegenerative or neuroimmunological diseases more vulnerable? Journal of Neurology, 268, 409–419. https://doi.org/10.1007/s00415-020-10070-8
(2021). The ApoE locus and COVID-19: Are we going where we have been? Journals of Gerontology: Series A, 76(2), e1–e3. https://doi.org/10.1093/gerona/glaa200
(2015). The development of the ICD-11 clinical descriptions and diagnostic guidelines for mental and behavioural disorders. World Psychiatry, 14, 82–90. https://doi.org/10.1002/wps.20189
(2021). Observational cohort study of neurological involvement among patients with SARS-CoV-2 infection. Therapeutic advances in neurological disorders, 14, 1756286421993701.
). (2010). NeuroRehabilitation: Ein Praxisbuch für interdisziplinäre Teams (3. Aufl.). Heidelberg: Springer.
(2020). Is the collapse of the respiratory center in the brain responsible for respiratory breakdown in COVID-19 patients? ACS Chemical Neuroscience, 11, 1379–1381. https://doi.org/10.1021/acschemneuro.0c00217
Gesellschaft für Neuropsychologie e. V. (2021a). Stellungnahme der Gesellschaft für Neuropsychologie (GNP) e. V. für den Dialog zur Weiterentwicklung der Hilfen für psychisch erkrankte Menschen [Pressemitteilung 18.02.21]. Verfügbar unter https://www.psychiatriedialog.de/fileadmin/downloads/Stellungnahmen_3_Dialog/20200218_SN_GNP.pdfGesellschaft für Neuropsychologie e. V. (2021b). Leitlinien. https://www.gnp.de/fachinformationen/leitlinien(1998).
Construction of a new fatigue assessment questionnaire . In A. Glaus, Fatigue in patients with cancer (Recent Results in Cancer Research, Vol. 145, pp. 54–76). Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-51466-1_4(2008). Delirium in the elderly. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 41, 431–439.
(1996). Ideomotor apraxia and cerebral dominance for motor control. Cognitive Brain Research, 3 (2), 95-100.
(1983). Assessment of aphasia and related disorders (2nd ed.). Philadelphia: Lea Febiger.
(2020). Mental health and clinical psychological science in the time of COVID-19: Challenges, opportunities, and a call to action. American Psychologist, 76, 409–426. https://doi.org/10.1037/amp0000707
(2017). Cognitive impairment in Multiple Sclerosis: A review of current knowledge and recent research. Reviews in the Neurosciences, 28, 845–860.
(2005). Multiple organ infection and the pathogenesis of SARS. Journal of Experimental Medicine, 202, 415–424. https://doi.org/10.1084/jem.20050828
(2020). Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. New England Journal of Medicine, 382, 1708–1720. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2002032
(2021). 18F-FDG brain PET hypometabolism in patients with long COVID. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 48, 2823–2833. https://doi.org/10.1007/s00259-021-05215-4
(2011). Efficacy of alertness training in a case of brainstem encephalitis: Clinical and theoretical implications. Neuropsychological Rehabilitation, 21, 164–182. https://doi.org/10.1080/09602011.2010.541792
(2020). Neurologic features in severe SARS-CoV-2 infection. New England Journal of Medicine, 382, 2268–2270. https://doi.org/10.1056/nejmc2008597
(2001). Verbaler Lern- und Merkfähigkeitstest – VLMT. Göttingen: Beltz Test.
(2011). Functional disability 5 years after acute respiratory distress syndrome. New England Journal of Medicine, 364, 1293–1304.
(2021). Zehn Argumente für dialogische Interaktion und kognitive Modelle als Grundlage neuropsychologischer Rehabilitation. Zeitschrift für Neuropsychologie, 32 (4), 229–242.
(2017). Neuropsychological characterization of three adolescent females with anti-NMDA receptor encephalitis in the acute, post-acute, and chronic phases: An inter-institutional case series. Clinical Neuropsychologist, 31, 268–288.
(2006). Brain atrophy and cognitive impairment in survivors of acute respiratory distress syndrome. Brain Injury, 20, 263–271. https://doi.org/10.1080/02699050500488199
(2005). Two-year cognitive, emotional, and quality-of-life outcomes in Acute Respiratory Distress Syndrome. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 171, 340–347. https://doi.org/10.1164/rccm.200406-763OC
(2005). Impact of severe acute respiratory syndrome (SARS) on pulmonary function, functional capacity and quality of life in a cohort of survivors. Thorax, 60, 401–409. https://doi.org/10.1136/thx.2004.030205
(2013). Olfactory dysfunction: Common in later life and early warning of neurodegenerative disease. Deutsches Ärzteblatt International, 110, 1–7.
(2020). Persistent depressive symptoms, HPA-axis hyperactivity, and inflammation: The role of cognitive-affective and somatic symptoms. Molecular Psychiatry, 25, 1130–1140. https://doi.org/10.1038/s41380-019-0501-6
(2009). Acute respiratory distress syndrome, sepsis, and cognitive decline: A review and case study. Southern Medical Journal, 102, 1150–1157.
(2020). Neuropsychologische Tests in der Demenzdiagnostik: Wann und womit? Schweizer Zeitschrift für Psychiatrie & Neurologie, 1, 7–10. https://www.rosenfluh.ch/43679
Johns Hopkins University ,Medicine . (2021). Mortality Analysis: Cases and mortality by country. Retrieved October 12, 2021 from https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality(2012). Influenza infection induces neuroinflammation, alters hippocampal neuron morphology, and impairs cognition in adult mice. Journal of Neuroscience, 32, 3958–3968. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.6389-11.2012
(2004). DemTect: a new, sensitive cognitive screening test to support the diagnosis of mild cognitive impairment and early dementia. International journal of geriatric psychiatry, 19 (2), 136-143.
(1982). Western Aphasia Battery. San Antonio, TX: Psychological Corporation.
(1990). Mini-Mental-Status-Test (Deutschsprachige Fassung). Göttingen: Beltz Test.
(2020). Incidence of thrombotic complications in critically ill ICU patients with COVID-19. Thrombosis Research, 191, 145–147.
(2021). S1-Leitlinie Post-COVID/Long-COVID. AWMF-Register-Nr. 020-027. Verfügbar unter https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/020-027l_S1_Post_COVID_Long_COVID_2021-07.pdf
(2019). Cognitive deficits following intensive care. Deutsches Ärzteblatt International, 116, 627–634.
(2000). Wisconsin Card Sorting Test – WCST, 64 Card Version. Lutz, FL: Psychological Assessment Resources.
(2019). Clinical symptoms and markers of disease mechanisms in adolescent chronic fatigue following Epstein-Barr virus infection: An exploratory cross-sectional study. Brain, Behavior, and Immunity, 80, 551–563. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2019.04.040
(2021). Physical phenotype of blood cells is altered in COVID-19. Biophysical journal, 120 (14), 2838–2847. https://doi.org/10.1016/j.bpj.2021.05.025L
(2009). Mental morbidities and chronic fatigue in Severe Acute Respiratory Syndrome survivors: Long-term follow-up. Archives of Internal Medicine, 169, 2142–2147. https://doi.org/10.1001/archinternmed.2009.384
(2020). Gibt es ein Post-COVID-Syndrom? Der Pneumologe, 17, 398–405. https://doi.org/10.1007/s10405-020-00347-0
(2007). Cognitive sequelae in acute respiratory distress syndrome patients with and without recall of the intensive care unit. Journal of the International Neuropsychological Society, 13 (4), 595-605. https://doi.org/10.1017/S1355617707070749
(2004). Neuropsychological assessment. Oxford: Oxford University Press.
(2021). More than 50 long-term effects of COVID-19: A systematic review and meta-analysis. medRxiv. https://doi.org/10.1101/2021.01.27.21250617
(2009). Long-term psychiatric morbidities among SARS survivors. General Hospital Psychiatry, 31, 318–326. https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2009.03.001
(2020). Neurologic manifestations of hospitalized patients with coronavirus disease 2019 in Wuhan, China. Journal of the American Medical Association Neurology, 77, 683–690. https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2020.1127
(2020). Neuropathology of patients with COVID-19 in Germany: A post-mortem case series. Lancet Neurology, 19, 919–929. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(20)30308-2
(2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19). UpToDate Hirsch MS Bloom, 5 (1).
(2019). Return to employment after critical illness and its association with psychosocial outcomes: A systematic review and meta-analysis. Annals of the American Thoracic Society, 16, 1304–1311. https://doi.org/10.1513/AnnalsATS. 201903-248OC
(1926). Influenza and schizophrenia. American Journal of Psychiatry, 82, 469–529. https://doi.org/10.1176/ajp.82.4.469
(1995). Rey Complex Figure Test and recognition trial. Lutz, FL: Psychological Assessment Resources.
(2002). The role of macrophage/microglia and astrocytes in the pathogenesis of three neurologic disorders: HIV-associated dementia, Alzheimer disease, and Multiple Sclerosis. Journal of the Neurological Sciences, 202, 13–23. https://doi.org/10.1016/S0022-510X(02)00207-1
(2009).
Neuropsychologische Defizite bei zerebrovaskulären Erkrankungen . In W. Sturm, M. Herrmann & F.T. Münte (Hrsg.), Lehrbuch der Klinischen Neuropsychologie (2. Aufl., S. 740–750). Heidelberg: Springer Spektrum.(2021). Stroke in COVID-19: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Stroke, 16, 137–149. https://doi.org/10.1177/1747493020972922
(2005). The Montreal Cognitive Assessment, MoCa: A brief screening tool for mild cognitive impairment. Journal of the American Geriatrics Society, 53, 695–699. https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2005.53221.x
(2021). Prevalence of hyposmia and hypogeusia in 390 COVID-19 hospitalized patients and outpatients: A cross-sectional study. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 40, 691–697. https://doi.org/10.1007/s10096-020-04056-7
(2011). Association of seropositivity for influenza and coronaviruses with history of mood disorders and suicide attempts. Journal of Affective Disorders, 130, 220–225. https://dx.doi.org/10.1016 %2Fj.jad.2010.09.029
(2020). A dynamic immune response shapes COVID-19 progression. Cell Host & Microbe, 27, 879–882.e2. https://doi.org/10.1016/j.chom.2020.03.021
(2020). Large-vessel stroke as a presenting feature of COVID-19 in the young. New England Journal of Medicine, 382, e60. https://doi.org/10.1056/NEJMc2009787
(2020). Anti-NMDA receptor encephalitis in a psychiatric COVID-19 patient: A case report. Brain, Behavior and Immunity, 87, 179–181. https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.bbi.2020.05.054
(2021). A call for the World Health Organization to create international classification of disease diagnostic codes for Post-Intensive Care Syndrome in the age of COVID-19. World Medical & Health Policy, 13. https://doi.org/10.1002/wmh3.401
(2006). Functional neuroimaging studies of emotional learning and autonomic reactions. Journal of Physiology Paris, 99, 342-354.
(2018). The value of the lens model paradigm in neuropsychological assessment. Zeitschrift für Neuropsychologie, 29, 258–276. https://doi.org/10.1024/1016-264X/a000235
(2012). Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition (Deutschsprachige Adaptation der WAIS-IV von D. Wechsler). Frankfurt am Main: Pearson Assessment.
(2020). Clinical judgement is paramount when performing cognitive screening during COVID-19. Journal of the American Geriatrics Society, 68, 1390–1391. https://doi.org/10.1111/jgs.16559
(2020). Stroke priorities during COVID-19 outbreak: acting both fast and safe. Journal of stroke and cerebrovascular diseases, 29 (8), 104922. https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.104922
(2020). COVID-19-associated acute hemorrhagic necrotizing encephalopathy: Imaging features. Radiology, 296, e119–e120. https://doi.org/10.1148/radiol.2020201187
(2019). In search of distinct MS-related fatigue subtypes: Results from a multi-cohort analysis in 1.403 MS patients. Journal of Neurology, 266, 1663–1673.
(2021). Psychosoziale Unterstützung während der COVID-19-Pandemie: interdisziplinäres Versorgungskonzept an einem Universitätsklinikum. Der Nervenarzt, 92(7), 701–707. https://doi.org/10.1007/s00115-020-01014-8
(1992). Trail Making Test – TMT. Tucson, AZ: Reitan Neuropsychology Laboratory.
(2020). COVID-19 and clinical neuropsychology: A review of neuropsychological literature on acute and chronic pulmonary disease. Clinical Neuropsychologist, 34, 1480–1497. https://doi.org/10.1080/13854046.2020.1810325
Robert Koch Institut . (2021a). Aktuelle Daten und Informationen zu Infektionskrankheiten und public Health Epidemiologisches Bulletin. Zugriff am 1. April 2021 unter https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/13_21.pdf?__blob=publicationFileRobert Koch Institut (2021b). COVID-19 Impfdashboard: Aktueller Impfstatus. Zugriff am 12. Oktober 2021 unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html;jsessionid=1A39D5A4100AA89BC7CD6C7FB5384258.internet091?nn=13490888Robert Koch Institut . (2021c). Epidemiologischer Steckbrief zu SARS-CoV-2 und COVID-19. Zugriff am 14. Juli 2021 unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText16Robert Koch Institut . (2020). Epidemiologischer Steckbrief zu SARS-CoV-2 und COVID-19. Zugriff am 13. August 2020 unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText16Robert Koch Institut . (2021d). Epidemiologischer Steckbrief zu SARS-CoV-2 und COVID-19: Manifestationsindex. Zugriff am 17. März 2021 unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.htmlRobert Koch Institut (2021e). Hinweise zur Testung von Patienten auf Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2. Zugriff am 21. September 2021 unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.htmRobert Koch Institut (2021f). Wöchentlicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19). Zugriff am 7. Oktober 2021 unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbericht_2021-10-07.pdf?__blob=publicationFile(2021). Post COVID-19 in children, adolescents, and adults: results of a matched cohort study including more than 150,000 individuals with COVID-19. MedRxiv. https://doi.org/10.1101/2021.10.21.21265133
(2020). Psychiatric and neuropsychiatric presentations associated with severe coronavirus infections: A systematic review and meta-analysis with comparison to the COVID-19 pandemic. Lancet Psychiatry, 7, 611–627. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30203-0
(2021). Pediatrician, watch out for corona-phobia. European Journal of Pediatrics, 180, 201–206. https://doi.org/10.1007/s00431-020-03736-y
(2020). The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Journal of Autoimmunity, 109, 102433. https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102433
(2014). Clinical aspects and outcomes of 70 patients with Middle East respiratory syndrome coronavirus infection: A single-center experience in Saudi Arabia. International Journal of Infectious Diseases, 29, 301–306. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2014.09.003
(2017). Epigenetic Landscape during Coronavirus Infection. Pathogens, 6, 8. https://doi.org/10.3390/pathogens6010008
(2014). Psychologische Diagnostik kompakt: Komplexität diagnostischer Datensätze. Weinheim: Beltz.
(1996). Wiener Testsystem: Computergestützte psychologische Diagnostik. Mödling: Schuhfried GmbH.
(2008). Polypharmacy and inappropriate prescribing in elderly internal-medicine patients in Austria. Wiener klinische Wochenschrift, 120, 733–741. https://doi.org/10.1007/s00508-008-1089-z
(2020). A review of the progress and challenges of developing a vaccine for COVID-19. Frontiers in Immunology, 11, 585354. https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.585354
(2016). Operationalizing NIMH Research Domain Criteria (RDoC) in naturalistic clinical settings. Bulletin of the Menninger Clinic, 80, 187–212. https://doi.org/10.1521/bumc.2016.80.3.187
(2020). COVID-19 infection: Origin, transmission, and characteristics of human coronaviruses. Journal of Advanced Research, 24, 91–98. https://doi.org/10.1016/j.jare.2020.03.005
(1995). The multidimensional fatigue inventory (MFI) psychometric qualities of an instrument to assess fatigue. Journal of Psychosomatic Research, 39, 315–325. https://doi.org/10.1016/0022-3999(94)00125-o
(2018). Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Evidence for an autoimmune disease. Autoimmunity Reviews, 17, 601–609. https://doi.org/10.1016/j.autrev.2018.01.009
(2020). Neuropsychology in the times of COVID-19: The role of the psychologist in taking charge of patients with alterations of cognitive functions. Frontiers in Neurology, 11, 573207. https://doi.org/10.3389/fneur.2020.573207
Ständiger Arbeitskreis der Kompetenz- und Behandlungszentren für Krankheiten durch hochpathogene Erreger am Robert Koch-Institut . (2021). Hinweise zu Erkennung, Diagnostik und Therapie von Patienten mit COVID-19. Robert Koch Institut. Zugriff am 28. April 2021 unter https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/Stakob/Stellungnahmen/Stellungnahme-COVID-19_Therapie_Diagnose.pdf?__blob=publicationFileStatista . (2021). Reproduktionszahl des Coronavirus (COVID-19) in Deutschland seit April 2020. Zugriff am 4. März 2021 unter https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1117478/umfrage/reproduktionszahl-des-coronavirus-COVID-19-in-deutschland/(2020). How does Coronavirus affect the brain? Retrieved from https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/how-does-coronavirus-affect-the-brain
(2020). Characterization of the receptor-binding domain (RBD) of 2019 novel coronavirus: Implication for development of RBD protein as a viral attachment inhibitor and vaccine. Cellular & Molecular Immunology, 17, 613–620. https://doi.org/10.1038/s41423-020-0400-4
(2021). Bidirectional associations between COVID-19 and psychiatric disorder: Retrospective cohort studies of 62 354 COVID-19 cases in the USA. Lancet Psychiatry, 8, 130–140. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30462-4
(2020). Symptom duration and risk factors for delayed return to usual health among outpatients with COVID-19 in a multistate health care systems network – United States, March–June 2020. MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report, 69, 993–998. https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6930e1
(2000). The CERAD neuropsychological assessment battery: A minimal data set as a common tool for German-speaking Europe. Neurobiology of Aging, 21, 30. https://doi.org/10.1016/S0197-4580(00)82810-9
(2021). Multisystem inflammatory syndrome in pediatric COVID-19 patients: A meta-analysis. World Journal of Pediatrics, 17, 141–151. https://doi.org/10.1007/s12519-021-00419-
(2004). Chronic fatigue and indicators of long-term employment disability in psychosomatic inpatients. Wiener Klinische Wochenschrift, 116, 182–189. https://doi.org/10.1007/BF03040485
(2020). Are we facing a crashing wave of neuropsychiatric sequelae of COVID-19? Neuropsychiatric symptoms and potential immunologic mechanisms. Brain, Behavior, and Immunity, 87, 34–39. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.04.027
(2021). Limbic encephalitis due to antineuronal antibodies: Neuropsychological aspects. Zeitschrift für Neuropsychologie, 32, 24–29. https://doi.org/10.1024/1016-264X/a000315
(2009).
Neuropsychologische Defizite nach Schädel-Hirn Trauma . In W. Sturm, M. Herrmann & T. Münte (Hrsg.), Lehrbuch der Klinischen Neuropsychologie (2. Aufl., S. 719–726). Heidelberg: Springer Spektrum.(2016). The neurological and cognitive consequences of hyperthermia. Critical Care, 20, 199. https://doi.org/10.1186/s13054-016-1376-4
(2011). Diagnosticum für Cerebralschädigung II (DCS-II). Ein figuraler Lern-und Gedächtnistest nach F. Hillers. Bern: Huber.
(1999). Chronic fatigue and its syndromes (Repr). Oxford: Oxford Univ. Press.
(2007). The characteristics of fatigue in an older primary care sample. Journal of Psychosomatic Research, 62,153–158.
(1996). Behavioural assessment of the dysexecutive syndrome. Frankfurt am Main: Pearson.
(2020). Neuropsychological consequences of COVID-19. Neuropsychological Rehabilitation, 30, 1625–1628. https://doi.org/10.1080/09602011.2020.1808483
(2002). Cytokines and cognition: The case for a head-to-toe inflammatory paradigm. Journal of the American Geriatrics Society, 50, 2041–2056. https://doi.org/10.1046/j.1532-5415.2002.50619.x
(2002). Evaluationsforschung und Programmevaluation im Gesundheitswesen. Zeitschrift für Evaluation, 1, 39–60.
World Health Organization . (2003). Consensus document on the epidemiology of severe acute respiratory syndrome (SARS). Retrieved from https://www.who.int/csr/sars/en/WHOconsensus.pdfWorld Health Organization . (2019). Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV). Retrieved from https://www.who.int/health-topics/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-mers#tab=tab_1World Health Organization . (2021). COVID-19: vulnerable and high risk groups. Retrieved June 29, 2021 from https://covid19.who.int/ https://www.who.int/westernpacific/emergencies/COVID-19/information/high-risk-groupsWorld Health Organization . (2021). WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. Retrieved October 12, 2021 from https://covid19.who.int/(2020). Nervous system involvement after infection with COVID-19 and other coronaviruses. Brain, Behavior, and Immunity, 87, 18–22. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.03.031
(2020). Self-reported olfactory loss associates with outpatient clinical course in COVID-19. International Forum of Allergy & Rhinology, 10, 821–831. https://doi.org/10.1002/alr.22592
(2020). COVID-19 and multiorgan response. Current problems in cardiology, 45 (8), 100618. https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2020.100618
(2021). COVID-19 and anti-N-methyl-d-aspartate receptor (anti-NMDAR) encephalitis: Are we facing an increase in the prevalence of autoimmune encephalitis? Journal of Medical Virology, 93, 1913–1914.
(2020). Prevalence of comorbidities and its effects in patients infected with SARS-CoV-2: a systematic review and meta-analysis, International Journal of Infectious Diseases, 94, 91-95, ISSN 1201–9712. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.03.017.
(2002). Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung – TAP. Herzogenrath: Psytest-Verlag.
(1991). Ein Fragebogen erlebter Defizite der Aufmerksamkeit (FEDA). Freiburg: Psychologisches Institut der Universität Freiburg.



