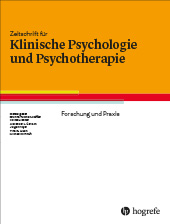COVID-19: Psychologische Folgen für Familie, Kinder und Partnerschaft
Abstract
Zusammenfassung. Dieser Beitrag soll die spezifischen Auswirkungen auf Familien, Kinder und Partnerschaften diskutieren, die sich durch die Covid-19-Pandemie einstellen könnten. Er ist primär gedacht für alle professionellen Helfer, die in Kontakt mit betroffenen Familien stehen. Die COVID-19-Pandemie stellt eine akute Bedrohung für das familiäre Wohlergehen dar, da sie mit psychologischen Reaktionen (z. B. Angst, Depression, Wut) der Familienangehörigen sowie sozialen Belastungen, die durch finanzielle Unsicherheit, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und Existenzängsten bedingt sind, verbunden sein kann. Mehr als 70 % der Kinder und Jugendlichen fühlen sich seelisch belastet und jedes vierte Kind berichtet, dass es in der Familie häufiger zu Streit komme als vor der Corona-Krise. Die elterliche Partnerschaft bildet den Kern des familiären Funktionierens, jedoch kann das Coparenting in der Krise erschwert sein. Im Zuge der Ausgangsbeschränkungen und der damit einhergehenden Isolierung von Familien ist weiterhin zu befürchten, dass Beziehungskonflikte zunehmen und Partner_innen und Kinder einem erhöhten Risiko körperlicher, emotionaler und sexueller Gewalt ausgesetzt sind. Was dringend fehlt sind Interventionsformen, die zum Ziel haben, fortschreitende Eskalationen zu verhindern und rechtzeitig Wege aufzuzeigen, wie eine konstruktive Wendung erreicht werden kann. Es werden vier Empfehlungen ausgesprochen: (1) Entwicklung und Förderung von Internetplattformen, die Informationen zum angemessenen Umgang mit familiären Krisensituationen bereitstellen. (2) Finanzielle Förderung der Nutzung von interaktiven Online-Programmen insbesondere für finanzschwache Familien. (3) Aufklärungskampagnen initiieren und finanzieren. (4) Fragwürdige / schädliche Online-Programme identifizieren. Abschließend findet sich eine Zusammenstellung von personenungebundenen, Internet-basierten Angeboten, die helfen können, mit den durch COVID-19 zu erwartenden Schwierigkeiten im Familienleben besser umgehen zu können – dies vor allem mit einfach umsetzbaren Hilfestellungen und Ratschlägen.
Abstract. This paper discusses the specific impact of the Covid-19 pandemic on family life, children, and relationships. It is addressed to all professionals in contact with affected families. The COVID-19 pandemic poses an acute threat to family well-being, as it may be associated with the psychological reactions (e. g., anxiety, depression, anger) of family members as well as causing social stressors related to financial insecurity, reduced working hours, unemployment, and existential fears. More than 70 % of children and adolescents feel emotionally distressed, and one in four children report family arguments being more frequent than before the Corona crisis. Parental partnership lies at the core of family functioning, but coparenting may have become more difficult during the crisis. In the wake of social distancing restrictions and the resulting isolation of families, there is still concern that relationship conflicts will increase, and that both partners and children will be at greater risk of physical, emotional, and sexual violence in the family. What is urgently lacking are adequate interventions to prevent escalations in families and to provide ways to achieve a constructive turnaround. Four recommendations are made: (1) develop and promote internet platforms that provide information on how to appropriately handle family crises; (2) provide financial support for the application of interactive online programs, especially for financially disadvantaged families; (3) initiate and fund respective marketing campaigns; (4) identify questionable / harmful online programs. Finally, the article provides a compilation of nonpersonal, internet-based interventions that can help to better cope with the expected difficulties in family life because of COVID-19, combined with easy-to-implement assistance and advice for dealing with other family members in psychologically stressful situations.
Ausgangslage: COVID-19 und psychische Probleme
Dieser Beitrag soll die spezifischen Auswirkungen auf Familien beleuchten, die sich durch die Covid-19-Pandemie einstellen könnten. Er ist primär gedacht für alle professionellen Helfer, die in Kontakt mit betroffenen Familien stehen. Diskutiert werden die aktuellen empirischen Befunde hinsichtlich der psychischen, sozialen und ökonomischen Folgen und allgemein zugängliche, vor allem web-basierte Hilfen, die Familien in Krisen in Anspruch nehmen können.
Innerhalb weniger Wochen hat die SARS-CoV-2 / COVID-19-Pandemie das Leben vieler Menschen rund um den Globus zum Teil radikal verändert. Psychologisch kann sie als ein neuer multidimensionaler und potenziell toxischer Stressfaktor aufgefasst werden, der auch in Deutschland nachweislich zu vermehrten psychischen Problemen in der Allgemeinbevölkerung führt und vermutlich mittel- und langfristig einen deutlichen Anstieg der Inzidenz- und Prävalenzraten psychischer Störungen bedingen wird (Brakemeier et al., 2020; Feinberg et al., 2021; Gruber et al., 2020; Liu, Zhang et al., 2020; Pierce et al., 2020; Taylor, 2020; Westtrupp et al., 2021; Zielasek & Gouzoulis-Mayfrank, 2020). Zu diesen psychischen Störungen zählen z. B. Depressionen, Ängste, Posttraumatische Belastungsstörungen, Schlafstörungen oder Suizidalität. Darüber hinaus klagen viele über Symptome wie vermehrte Sorgen, Müdigkeit, Wut, Reizbarkeit, Langeweile, Resignation, Einsamkeit, Perspektivlosigkeit und Stigmatisierungserfahrungen.
Zusätzlich werden viele Menschen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie auch finanzielle Krisen erleben, die das seelische Wohlbefinden beeinträchtigen können. Es gibt Hinweise aus vergangenen Pandemien, dass die psychischen Beeinträchtigungen nicht nur kurzfristig bestehen, sondern auch länger andauern können (Brooks et al., 2020; Leopoldina, 2020). Studien kamen zu dem Ergebnis, dass Personen, die während der Rezession 2008/2009 mindestens eine finanzielle, arbeits- oder wohnungsbezogene Einbuße erlebt hatten, bis zu vier Jahre nach dem Ende der Rezession immer noch eine höhere Wahrscheinlichkeit aufwiesen, Symptome von Depression, Angst und problematischem Substanzkonsum zu zeigen (Forbes & Krueger, 2019; Frone, 2016; Georgiadou et al., 2020). Es ist davon auszugehen, dass die Belastungen umso größer sind, je länger die Quarantänemaßnahmen und Kontaktbeschränkungen andauern (Brooks et al., 2020).
Personen in sogenannten systemrelevanten Berufen, insbesondere medizinisches, pflegerisches und therapeutisches Personal, sind besonders durch die Pandemie gefährdet. Dies betrifft neben einer gestiegenen Arbeitsbelastung und einem erhöhten Infektionsrisiko auch das Risiko, an einer Stressfolgestörung, Depression oder Angststörung zu erkranken (Bohlken et al., 2020; Liu, Yang et al., 2020). Dazu kommt bei vielen die Sorge, sie könnten berufsbedingt ihre Angehörigen anstecken.
Bereits vor der aktuellen Pandemie waren psychische Störungen in Deutschland weit verbreitet: Mehr als jede vierte Person litt im Zeitraum eines Jahres unter mindestens einer psychischen Erkrankung (Jacobi et al., 2014). Bei Kindern und Jugendlichen betrug die Prävalenzrate knapp 20 % (Klipker et al., 2018). Bei der Interpretation dieser Prozentangaben ist zu bedenken, dass nicht jede Patientin bzw. jeder Patient mit einer psychischen Störung tatsächlich auch einen Versorgungsbedarf hat. Welche langfristigen Auswirkungen die COVID-19-Pandemie jedoch auf vorbestehende psychische Erkrankungen hat ist bisher nicht bekannt. Vorläufige Daten deuten allerdings darauf hin, dass die Pandemie eine bereits zuvor bestehende psychische Störung eher noch verschlimmert (Brakemeier et al., 2020; Westrupp et al., 2020).
COVID-19: Auswirkungen auf Familien
Die Familie war auch 2019 für 77 % der Bevölkerung nach wie vor der wichtigste Lebensbereich, noch vor dem Beruf und dem Freundeskreis. Bei Eltern mit minderjährigen Kindern waren es sogar 91 %. In den zurückliegenden Jahren ist die Wertschätzung der Familie konstant hoch geblieben und seit 2006 nahezu unverändert (BMFSFJ, 2020).
Die Nationalakademie Leopoldina betont in ihrer Stellungnahme die große Bedeutung der Familie für die Bewältigung der Krise: „Angesichts der derzeit geltenden Maßnahmen kommt Familien und anderen Formen von Partnerschaften eine zentrale Rolle zu. Sie verbleiben oft als einziger Ort, an dem dringliche Lebensvollzüge einschließlich Ernährung und Konsum, Face-to-Face-Kommunikation und Geselligkeit, Kindererziehung, Bildung und Unterhaltung, aber auch Spannungsabbau und das Austragen von Konflikten noch stattfinden“ (Leopoldina, 2020, S. 4). Die COVID-19-Pandemie stellt jedoch auch eine akute Bedrohung für das familiäre Wohlergehen dar, da sie mit psychologischen Reaktionen (z. B. Angst, Depression, Wut) der Familienangehörigen sowie sozialen Belastungen, die durch finanzielle Unsicherheit, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und Existenzängsten bedingt sind, verbunden sein kann. Wie der FamilienMonitor Corona (2021) zeigt, ist im Vergleich zu Werten vor der Pandemie speziell die Zufriedenheit mit der Kinderbetreuung und dem Familienleben gesunken. Zudem machen sich 60 % der Eltern um die Bildung, 57 % um die wirtschaftliche Zukunft und 39 % um die Gesundheit ihrer Kinder große Sorgen.
Neben der Sorge um ihre Kinder sind Erwachsene zusätzlich mit besonderen und neuen Herausforderungen konfrontiert, wenn sie Angehörige pflegen oder mitversorgen müssen. Dies gilt insbesondere dann, wenn diese einer Risikogruppe für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf angehören. Auch wenn ihre Eltern in Alten- oder Pflegeheimen leben, können Sorgen und Ängste im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie zunehmen (Brakemeier et al., 2020; Prime et al., 2020).
Generell können in Familien durch die plötzliche Notwendigkeit, sehr viel Zeit bei gleichzeitiger Reduktion anderer sozialer und beruflicher Aktivitäten miteinander zu verbringen, vermehrt Konflikte bis hin zu körperlicher Gewalt entstehen – insbesondere bei räumlicher Enge und fehlenden Rückzugsmöglichkeiten. Diese Gefahr wächst mit zunehmender Dauer und steigenden wirtschaftlichen bzw. sozialen Folgeproblemen der Pandemie, insbesondere aber durch die Schließung von Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie Home-schooling (Langmeyer et al., 2020). Vor allem Alleinerziehende sind durch die alleinige Verantwortung bei der Beaufsichtigung ihrer Kinder besonders betroffen (Wildemann & Hosenfeld, 2020). Aber auch Eltern von Kindern mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen und psychischen Störungen erhalten während eines Lockdowns ebenfalls keine bzw. kaum Unterstützung und müssen den Mehrbedarf, der über die fehlende externe Betreuung entsteht, allein bewältigen. Die Teilhabe sowie die Chancengleichheit dieser Kinder im Bildungssystem werden dadurch erschwert und zum Teil sogar unmöglich gemacht.
Vor diesem Hintergrund ist es für Familien insbesondere während einer Krise wichtig, ihre Beziehungen und gemeinsamen Überzeugungen zu erhalten und sich an die neuen Bedingungen anzupassen. Eltern sollten versuchen, ihren Kindern in dieser Zeit ein Gefühl von Sicherheit und Hoffnung zu vermitteln. Dies stellt jedoch vor allem für Familien, die aufgrund ihrer früheren Lebensumstände, wie z. B. eines geringen Einkommens, einer schlechteren psychischen oder körperlichen Gesundheit und / oder Erfahrungen mit rassistischer Diskriminierung, stärker von der Pandemie betroffen sind als andere, eine besonders große Herausforderung dar. Die Folgen der Pandemie und die damit einhergehenden Schwierigkeiten werden insbesondere bei diesen Familien wahrscheinlich auch nach dem Abklingen der Pandemie längerfristig anhalten (Prime et al., 2020).
Bei aller Besorgtheit gelingt es dennoch vielen Paaren und Familien, auch die positiven ‚Nebenwirkungen‘ von Ausgangsbeschränkung, Kurzarbeit und Homeoffice in Kombination mit geschlossenen Sportstätten, Schulen und Kindergärten zu erkennen (BMFSFJ, 2020; Suhr, 2020): Sie verbringen sehr viel mehr Zeit miteinander. Bei aller Irritation durch die Gesamtlage versuchen viele Familien, „das Beste daraus zu machen“ und bei aller Improvisation des Alltaglebens möglichst viel „Quality Time“ mit dem bzw. der Partner_in und / oder der Familie zu verbringen. Viele Menschen besinnen sich wieder bewusster aufeinander und nehmen sich mehr Raum für persönlichen Austausch, für den vor der Pandemie oftmals keine Energie da war. Viele erleben diese Zeit auch als „entschleunigend“ und besinnen sich auf wichtige Werte. Geborgenheit und Zusammengehörigkeit werden für viele wieder deutlicher spürbar und Partnerschaft und Familie werden bewusster als emotionale Heimat erlebt. Gegenseitige Unterstützung und Schulterschluss stärken das Wir-Gefühl und erleichtern die Bewältigung der aktuellen Ausnahmesituation.
COVID-19: Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche
Auch Kinder und Jugendliche stehen in der Corona-Zeit unter großem Druck. In einer Studie der Ruhr-Universität Bochum mit über 3000 Eltern zeigte sich, dass auch schon die ganz Kleinen betroffen sind: Eltern von Babys und Kleinkindern beobachteten während des Lockdowns einen Anstieg von emotionalen und Verhaltensproblemen bei ihren Kindern. Auch nahm das Wohlbefinden der Eltern ab und erwies sich eng mit dem Befinden der Kinder verknüpft (Tisborn et al., 2021). Erste Studien des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf zeigen, dass mehr als 70 % der befragten Kinder und Jugendlichen sich durch die Corona-Krise seelisch belastet fühlen. Stress, Angst und Depressionen haben zugenommen. Jedes vierte Kind berichtet, dass es in der Familie häufiger zu Streit komme als vor der Corona-Krise (Ravens-Sieberer et al., 2020).
Die elterliche Partnerschaft bildet den Kern des familiären Funktionierens. Während Kinder von einer hohen Qualität der elterlichen Paarbeziehung und einer konstruktiven Konfliktaustragung profitieren, gehört das Miterleben von destruktiven Konflikten zwischen den Eltern zu einem bedeutenden Stressfaktor im Alltag eines Kindes. Insbesondere wenn Konflikte sehr häufig sind, mit hoher Intensität und körperlicher Aggression ausgetragen werden und ohne Konfliktlösung bleiben, bedrohen sie die emotionale Sicherheit eines Kindes (Cummings & Davies, 2010; Walper et al., 2017; Warmuth, Cummings & Davies, 2020).
Auch das Zusammenwirken beider Elternteile in der Erziehung, das sogenannte Coparenting, kann in einer Krise erschwert sein. So kann es Eltern schwerer fallen als Einheit aufzutreten und gemeinsam die Erziehungsverantwortung wahrzunehmen. Stattdessen kann es häufiger zu Konflikten über Erziehungsfragen kommen, bei denen die Elternteile ihre Erziehungsbemühungen möglicherweise sogar gegenseitig untergraben (Supke, Schulz & Hahlweg, 2020; Teubert & Pinquart, 2010; Zemp & Martensen, 2020).
Im Zuge der Ausgangsbeschränkungen und der damit einhergehenden Isolierung von Familien ist weiterhin zu befürchten, dass Kinder einem erhöhten Risiko körperlicher, emotionaler und sexueller Gewalt ausgesetzt sind. Dieses belegen auch die Ergebnisse von Studien aller größeren wirtschaftlichen Rezessionen der letzten Jahrzehnte (Brooks-Gunn et al., 2013; Schneider, Harknett & McLanahan, 2016). Laut Fegert und Kollegen (2020) ist aufgrund dieser Erfahrungen von einer weltweiten Zunahme der Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen durch die COVID-19-Pandemie auszugehen.
Obwohl in Deutschland bislang kein allgemeiner Anstieg zu verzeichnen ist (Bundesregierung, 2020), geht aus Erhebungen der Gewaltschutzambulanz der Charité hervor, dass beispielsweise in Berlin die Zahl der häuslichen Gewalttaten bei Paaren im Juni 2020 gegenüber 2019 bereits um 30 % angestiegen ist (Pressemitteilung des BMFSFJ, 28. 08. 2020). Wenn häusliche Gewalt zwischen Eltern vorliegt, haben auch Kinder ein deutlich erhöhtes Risiko, betroffen zu sein (Hahlweg et al., 2008). Da auch Daten aus anderen Ländern wie China, Brasilien, den USA, Frankreich oder Italien einen deutlichen Anstieg von Konflikten und Misshandlung in Familien als Folgen der Ausgangsbeschränkungen belegen (Campbell, 2020), ist zu befürchten, dass die Dunkelziffer in Deutschland zudem weitaus höher ist als die offiziell gemeldeten Fälle.
Eltern berichten aber auch von positiven Entwicklungen durch die Pandemie für ihre Kinder und Jugendlichen. So könnten diese mehr Zeit mit ihnen und ihren Geschwistern verbringen, hätten mehr Zeit für ihre Hobbys und könnten länger schlafen bzw. aufbleiben. Sie müssten nicht in die Schule gehen, könnten ihre schulischen Aufgaben flexibel und selbstbestimmter in den Alltag integrieren und diese im eigenen Lerntempo und ohne Konkurrenz- bzw. Leistungsdruck erledigen (Lochner, 2020). Auch würden ihre Freundschaften bzw. Partnerschaften intensiver und sie würden sich häufiger Gedanken über „wirklich“ wichtige Dinge, z. B. ihre schulische und berufliche Zukunft, machen.
COVID-19: Auswirkungen auf die Partnerschaft
Kontaktbeschränkungen und Quarantänemaßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Ausbreitung sind für viele Paare eine enorme Herausforderung. Die meisten Paare verbringen momentan so viel Zeit miteinander wie selten – leider nicht freiwillig. Gewohnte Abläufe, Rituale und Freiheitsgrade brechen weg. Täglich müssen schnell Lösungen improvisiert, neue Kompromisse gefunden und die permanent hereinprasselnden Corona-Nachrichten verarbeitet werden. Die diffusen Sorgen um die gesundheitliche und finanzielle Zukunft gehen bei einem Großteil der Paare einher mit Mehrarbeit, Organisationschaos und gravierenden Einschränkungen.
Wer seine Anstellung in Gefahr sieht, aber für das Einkommen der Familien verantwortlich ist, wer zur Risikogruppe gehört, sich aber nicht ins Homeoffice zurückziehen kann, wer sieht, dass die Kinder mit dem Lernen zuhause nicht klarkommen, ist selten entspannt und unbekümmert. Ohnehin hängen in Zeiten einer Pandemie Sorgen und Ängste geradezu in der Luft. Wer Glück hat, findet Verständnis und Halt bei seinem bzw. ihrer Partner_in. Sorgen können aber auch zum Mittelpunkt des grüblerischen Kreisens werden, bei dem es zunehmend schwerer wird, einen klaren Gedanken zu fassen. Ängste können überhand nehmen, und das Gefühl, dass einem alles zu viel wird und über den Kopf wächst, mag sich mit Wut und Verzweiflung mischen.
Viele Partner_innen haben in diesen Tagen kaum mehr die Möglichkeit, zwischendurch „ihren Akku wieder aufzuladen“ und sind dadurch schneller angespannt oder gereizt. Und wenn die Nerven blank liegen, nehmen Missverständnisse und Streit zu. Das hat nicht selten Auswirkungen auf Zärtlichkeit und Sexualität und belastet die Beziehungszufriedenheit zusätzlich. Vor allem folgende Schwierigkeiten können auftreten (Cluver et al., 2020; DGPs, 2020):
Verschlechterung der dyadischen Kommunikation. Es kann nicht überraschen, dass Partner_innen während einer Krise schneller aufbrausen, mehr schimpfen und einander öfter kritisieren oder sich vermehrt aus dem Weg gehen. Im Stressmodus schärfen sich die Sinne für Gefahren. Das Geben und Nehmen wird aufmerksamer überwacht und kritischer bilanziert. Die offene Zahnpastatube wird nicht zugeschraubt, sondern zum Anlass für einen Streit: „Immer vergisst du…, nie machst du….“. Nichtigkeiten werden Wichtigkeiten und allzu leicht fallen einem auch all die anderen Probleme ein, die dringend auf den Tisch müssten. Dadurch wird die gesamte partnerschaftliche Interaktion negativer und das Risiko für Streit, Eskalationen und Gewalt steigt.
Reduktion der positiven Interaktion. Selten passiert das zu Beginn einer Krisenphase, aber je länger die schwierige Situation andauert, desto mühsamer wird es, die innere Anspannung im Zaum zu halten, erst recht, wenn man sich kaum aus dem Weg gehen kann. Meist sind es zuerst die positiven Zeichen von Zuneigung, Wertschätzung, Fürsorge und Anteilnahme, die seltener werden. Denn häufig ziehen sich Menschen in belastenden Situationen zuerst einmal zurück – auch in der Partnerschaft. Man geht sich aus dem Weg und kapselt sich ab. Aufgrund der Einschränkungen durch die aktuelle COVID-19-Pandemie kann ein befriedender Rückzug gerade bei beengten Wohnverhältnissen schwierig werden. Leicht gerät er zum „dröhnenden Schweigen“, das den oder die andere bewusst ignoriert. Ist ein Rückzug nicht möglich und entfallen andere Möglichkeiten, um Dampf abzulassen, etwa der Sport, dann können sich Partnerschaftsprobleme verschärfen und in aggressives Verhalten oder auch körperliche Gewalt umschlagen.
Reduktion sexueller Aktivitäten. Wenn sich die Stimmung verschlechtert und Streit in der Luft liegt, werden Zärtlichkeit und erotische Annäherung rarer. Luetke et al. (2020) untersuchten in einer repräsentativen US-Stichprobe im April 2020 den Einfluss von Coronavirus-bedingten Beziehungskonflikten auf Veränderungen im intimen und sexuellen Verhalten. Von den Personen in Beziehungen berichteten 34 % über ein gewisses Maß an Konflikten mit ihren Partner_innen aufgrund der Verbreitung von COVID-19 und der damit verbundenen Einschränkungen. Diejenigen, die oft Coronavirus-bedingte Konflikte mit ihrem Partner_innen erlebten, berichteten über eine signifikant verringerte Häufigkeit sowohl zärtlichen Verhaltens wie Umarmen, Küssen, Händchen halten oder Kuscheln als auch sexueller Verhaltensweisen wie Masturbation, Geschlechtsverkehr, im Vergleich zu denjenigen, die keinen solchen Konflikt erlebten.
Zunahme von Ängsten und Sorgen. Als Folge kann sich die Angst entwickeln, dass die Partnerschaft eine solche Belastungsprobe nicht aushält, dass einem alles zu viel wird und über den Kopf wächst. Daraus können Wut und Verzweiflung resultieren. Sorgen und Ängste haben einen bedeutenden Einfluss auf das Schlafverhalten und Einschränkungen in der Schlafqualität wirken wiederum als Katalysatoren bestehender Probleme, Reizbarkeit und gesundheitlicher Einschränkungen.
Vermehrte körperliche Reaktionen. Streiten und die Auseinandersetzung mit Problemen ist anstrengend und kann zu Verspannungen, Rückenschmerzen, Müdigkeit und Erschöpfung führen. Manche Menschen regen sich sehr auf und haben dann z. B. einen erhöhten Herzschlag und Blutdruck oder werden motorisch sehr unruhig. Herz-Kreislauf-Störungen können zunehmen.
Zunahme an Grübeln und Schlaflosigkeit. Sorgen und Ängste nehmen gedanklich viel Raum ein. Häufig fangen Menschen dann an zu grübeln oder haben das Gefühl, dass sie keinen klaren Gedanken mehr fassen können. Das Grübeln und die häufig damit einhergehende Anspannung können ebenfalls die Schlafqualität vermindern.
Zunahme an Aggressivität und Gewalt. Wenn ein Rückzug nicht möglich ist, können sich Partnerschaftsprobleme verschärfen und in aggressives Verhalten oder auch körperliche Gewalt umschlagen.
Natürlich leiden nicht alle Partnerschaften unter der Pandemie. Es gibt auch Paare, deren Beziehung sich während der Krise im positiven Sinne intensiviert und die gestärkt aus diesen Corona-Zeiten herausgehen (sogenanntes posttraumatischem Wachstum; Baucom, Halford, Hahlweg & Weber, 2020). Im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie gibt es bislang noch keine wissenschaftlichen Studien dazu, welche Paare dies betrifft und welche Paare von einer Verschlechterung ihrer Beziehung betroffen sein werden. Daten des Beziehungs- und Familienpanels aus dem späten Frühjahr 2020 (Schmid et al., 2020) zeigen jedoch, dass Verschlechterungen der Paarbeziehungen überwiegen. Zwanzig Prozent der Befragten gaben an, sie seien in der Partnerschaft zufriedener als zu der Zeit, ehe COVID-19 in einen Lockdown mündete.
Für 40 % hatte sich die Partnerschaft verschlechtert, und zwar für Männer und Frauen gleichermaßen. Entsprechend den Ergebnissen der Befragung waren damals weder Kurzarbeit noch das Arbeiten im Homeoffice Risikofaktoren für eine größere Unzufriedenheit im Vergleich zu der Situation ein halbes Jahr zuvor. Und entgegen allen Erwartungen war die Fürsorge für Kinder eher ein stärkender Faktor für die Partnerschaft als ein zusätzlicher Stressfaktor.
Bei der Betrachtung der Auswirkungen der Pandemie auf Paare ist es sinnvoll, zwischen Themen zu unterscheiden, die sich (a) direkt auf die Infektion bzw. die Infektionsgefahr beziehen, und (b) Veränderungen im Leben des Paares, die sich aus dem Umgang mit dem Virus ergeben (z. B. eingeschränkte soziale Interaktionen, finanzielle Auswirkungen). So müssen sich fast alle Paare damit auseinandersetzen, dass eine/-r oder beide Partner_innen oder Familienmitglieder sich mit dem Virus infizieren, schwer erkranken und sogar sterben könnten. So berichteten in einer online-Studie im April / Mai 2020 (Hopf et al., 2021) fast ein Drittel der 1230 Teilnehmer_innen (n = 422) die Sorge, dass ein Familienmitglied sich infizieren könne – noch vor der Sorge, dass sie selbst isoliert sein könnten (n = 290). Wenn die Partner_innen versuchen, diese Sorgen oder Bedenken miteinander zu diskutieren, hängt der Erfolg ihres Gesprächs wahrscheinlich mit ihrer Kommunikationsfähigkeit zusammen, einem der besten langfristigen Prädiktoren für die Beziehungszufriedenheit und -stabilität (Pie et al., 2020; Pietromonaco, & Overall, 2020).
Mögliche partnerschaftliche Konfliktbereiche während der Pandemie. Paare, die bereits allgemeine Kommunikationsschwierigkeiten haben, können sich schwertun, über die Pandemie und ihre Sorgen zu sprechen. Partner_innen können sich darin unterscheiden, wie sie individuell mit Stressfaktoren wie dem Virus oder Existenzängsten umgehen. Ein/-e Partner_in möchte z. B. öfter über die möglichen Auswirkungen des Virus, oder der drohenden Arbeitslosigkeit sprechen, während der / die andere solche Diskussionen vermeidet, lieber einfach ‚weitermacht‘ und sich auf das Positive konzentriert. Solche Unterschiede können für Paare eine deutliche Herausforderung darstellen, da jede/-r versucht, den oder die andere so zu beeinflussen, dass er oder sie dem eigenen individuellen Bewältigungsstil entspricht.
Viele Paare haben Kinder, und die Fürsorge für sie steht im Mittelpunkt des familiären Alltags. Die zusätzliche Zeit mit den Kindern kann wertvoll sein, zumal viele Mütter und mehr noch Väter vor dem Ausbruch der Pandemie das Gefühl hatten, nicht genug für die Kinder da zu sein. Aber über Nacht die Kindergärtnerin oder den Lehrer ersetzen zu müssen, war für die meisten Eltern eine große Herausforderung und ist es auch noch, wenn bei einer Infektion in der Kita oder Schule das Kind in Quarantäne geschickt wird oder die Einrichtung schließt. Dass Homeoffice die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert, stimmt nur teilweise. Wenn parallel die Arbeit im Homeoffice erledigt und das Kleinkind betreut oder das Lernen der Schulkinder unterstützt werden muss, ist das keine Erleichterung, sondern ein harter bzw. oft nicht zu bewältigender Doppel-Job.
Darüber hinaus müssen sich Paare oft um ihre alternden Eltern kümmern, bei denen ein höheres Risiko für schwerwiegende Folgen einer Virusinfektion besteht. Paare, die sich eigentlich um ältere Familienmitglieder kümmern wollen, vermeiden aus Angst, diese anzustecken, den direkten Kontakt und fühlen sich hilflos, wie sie damit umgehen sollen. Paare müssen demnach in dieser außergewöhnlichen Situation auf die unterschiedlichen Bedürfnisse mehrerer Familienmitglieder eingehen können.
Für viele Paare hat sich die eingespielte Arbeitsteilung verändert, und oft muss neu ausgehandelt werden, beispielsweise wie beide von zu Hause aus arbeiten und sich gleichzeitig auch um die Kinder kümmern können. Immerhin scheinen die Chancen oft genutzt worden zu sein, die die neue Konstellation für eine stärkere Präsenz der Väter in der Familie und eine bessere Beteiligung an der Versorgung der Kinder geboten hat und bietet. Der zu Beginn der Pandemie vorhergesagte Traditionalisierungseffekt mit einer deutlich stärkeren Einbindung der Mütter in die Hausarbeit und die vermehrte Fürsorge für die Kinder hat sich jedenfalls überwiegend nicht eingestellt (Hank & Steinbach, 2020).
Enge soziale Beziehungen, körperliche Berührungen, aber auch symbolische Nähe, können die Stressbelastung puffern (Ditzen & Heinrichs, 2014) und das Leben verlängern (Holt-Lunstad, Smith & Layton, 2010). Neben stabilen sozialen Faktoren, wie dem Beziehungsstatus und der Familiengröße, haben hierbei die Beziehungsqualität (Robles, Slatcher, Trombello, & McGinn, 2014) und momentane soziale Interaktionen einen unmittelbaren Einfluss darauf, wie Individuen Stress regulieren können, was sich mittel- und langfristig auf ihre körperliche und psychische Gesundheit sowie sogar die Überlebensrate auswirkt. Dieser Effekt wird vermittelt über die körperlichen Stresssysteme, hier sind u. a. Katecholamine des sympathischen Nervensystems, das Steroid-Hormon Cortisol (als Effektor-Hormon der Stress-sensitiven Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden Achse, HHNA) und das Neuropeptid Oxytocin involviert (Eckstein et al., 2019).
Eine hohe Partnerschaftsqualität zeigt auf diese Systeme einen Haupteffekt und einen Puffereffekt: während der Haupteffekt beschreibt, dass Personen in einer glücklichen Beziehung generell niedrigere Stresslevel aufweisen, wird der Puffereffekt wirksam, wenn tatsächlich die Anforderungen ansteigen. Dann vermindern Nähe und soziale Unterstützung die unmittelbare Stressreaktion auf die Belastung. Familiäre Konflikte hingegen wirken als wiederholte und chronische Stressoren ebenfalls auf die Stresssysteme: Sie erhöhen dauerhaft den Cortisolspiegel und bewirken außerdem, dass Cortisol nach einer Belastung weniger schnell auf das Ursprungslevel zurückfällt (Ditzen et al., 2019). Familiäre Konflikte vermindern damit nicht nur die Lebensqualität, verstärken Depression und Angsterkrankungen und steigern die Suizidrate, sondern sind auch auf körperlicher Ebene mit beeinträchtigter Immunkompetenz (auch in Bezug auf COVID-19!) und schlechteren kardiovaskulären Parametern assoziiert. Sie stellen damit nicht nur ein langfristiges Risiko dar, um mit der Belastung durch die COVID-19-Pandemie zurecht zu kommen, sondern verschlechtern auch die Heilungschancen derjenigen, die erkrankt sind (Feinberg et al., 2021).
Gewalt in intimen Partnerschaften
Angesichts der Corona-Krise wird eine starke Zunahme von Fällen häuslicher Gewalt, deren Prävalenz schon jetzt sehr hoch ist, von vielen Expertinnen und Experten befürchtet. Diese Annahmen gründen sich auf Studien, die zeigten, dass nach allen größeren wirtschaftlichen Rezessionen der letzten Jahrzehnte (Große Depression 1929 – 1938; Finanzkrise 2017 – 2009) ein deutlicher Anstieg der häuslichen Gewalt zu verzeichnen war (Brooks-Gunn et al., 2013; Schneider et al., 2016). Um abschätzen zu können, wie groß der Hilfebedarf von Opfern familiärer Gewalt sein könnte, erscheint es wichtig, die Verbreitung und die psychologischen und physischen Folgen von familiärer Gewalt aufzuzeigen, wie sie sich vor der Corona-Krise dargestellt haben.
Gewalt in intimen Partnerschaften ist sehr häufig und hat bedeutsame Auswirkungen auf das familiäre Umfeld, insbesondere für die Kinder. Destruktive Paarkonflikte spielen oft eine große Rolle beim Auftreten von Gewalt. Die Streitmuster der Partner_innen werden im Verlauf der Beziehung zunehmend feindseliger und eskalieren bis hin zu körperlicher Gewalt, ohne dass eine adäquate Problemlösung gefunden werden oder eine Versöhnung stattfinden kann. Die Interaktionen werden als verletzend erlebt (z. B. wird häufig provoziert, die Partner_innen verächtlich und demütigend behandelt und neben körperlicher auch verbale Gewalt ausgeübt).
In Deutschland beträgt die Lebenszeitprävalenz von physischer und sexueller Gewalt durch eine Intimpartner_in 25 %, wobei überwiegend Männer als Täter auftreten. Deutschland liegt dabei im europäischen Vergleich im mittleren Bereich (World Health Organization, 2013). Im Jahr 2019 wurden nach den Daten des Bundeskriminalamtes (2020) 115.000 Frauen (81 %; Männer 27.000, 19 %) Opfer von Partnerschaftsgewalt durch ihre Ehe- oder Lebenspartner (Mord, Totschlag, Körperverletzung, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Bedrohung, Stalking, Zwangsprostitution). Statistisch gesehen wird in Deutschland an jedem dritten Tag eine Frau getötet. Mehr als ein Mal pro Stunde wird eine Frau durch ihren Partner gefährlich körperlich verletzt (Bundesregierung, 2020). Hierbei handelt es sich um sog. Hellfeld-Daten, die von der Polizei ermittelt wurden. Der Anteil der nicht-registrierten Kriminalität (Dunkelfeld) liegt wahrscheinlich deutlich höher.
Gewalt gegen Frauen ist kein schichtabhängiges Phänomen, sondern zeigt sich in allen sozioökonomischen Gruppen und Altersstufen. Die Opfer werden geprügelt, zusammengeschlagen, getreten, gewürgt, mit einer Waffe bedroht oder absichtlich mit heißem Wasser verbrüht. Die Wahrscheinlichkeit von Gewalterfahrungen durch den Partner steigt bei Trennung und Scheidung deutlich an und liegt für geschiedene / getrennte Frauen doppelt so hoch wie bei verheirateten Frauen. Für die Opfer von Gewalt in Partnerschaften steigt das Risiko, an einer psychischen (Depression, Angststörungen, Posttraumatische Belastungsstörung, Suizidversuch) und / oder physischen Störung (psychosomatische Symptome wie Rückenschmerzen, chronische gastrointestinale Beschwerden) zu erkranken. Häusliche Gewalt durch den Partner ist auch ein zentraler Risikofaktor für Kinder und Jugendliche, psychische Störungen zu entwickeln, da sie das Vertrauen und das kindliche Sicherheitsgefühl in der Familie unterminieren.
Therapeutische Interventionen für die Täter sind leider nur in begrenztem Maße wirksam. Dies liegt unter anderem daran, dass die Tätergruppe sehr heterogen ist. Nach einer in den USA häufig genutzten Typologie (Holtzworth-Munroe et al., 2000) gibt es verschiedene Tätertypen. Die Kenntnis dieser Typen ist wesentlich, um zu entscheiden, ob ein Täter überhaupt in ein entsprechendes Programm aufgenommen wird und welche Interventionen evtl. wirksam sein könnten. Eine wichtige Unterscheidung bezieht sich darauf, ob ein Täter ausschließlich innerhalb der Familie oder generell, also auch außerhalb der Familie, gewalttätig wird. Unterschieden wird zwischen Tätern, die nur in der Familie gewalttätig werden (Steingen, 2020): („Familienbezogener Typus“, ca. 35 % aller Täter), „Dysphorische / Borderline Täter“ (15 %), „Generell auch außerhalb der Familie gewalttätig / Antisoziale Täter“ (16 %), „Antisoziale Persönlichkeit, Gewalt nur in der Familie“ (33 %).
Bezüglich möglicher psychosozialer Interventionen für die Opfer herrscht bei den Fachkräften in der Täterarbeit Übereinkunft, dass in Fällen häuslicher Gewalt die vorgeschaltete individuelle Teilnahme an einem – meist in Gruppen durchgeführten -Täterprogramm in Hinblick auf die Erarbeitung einer einvernehmlichen Täter / Opfer-Regelung – falls eine solche nicht von vornherein aufgrund der Gewaltvorgeschichte ausscheidet – regelmäßig sinnvoll sein dürfte (Steingen, 2020). Klassische Scheidungs-, Trennungs- bzw. Paarberatung ist bei gewaltbelasteten Paaren vom Grundsatz her ungeeignet, denn dies birgt für das Opfer das Risiko der Reviktimisierung und des Erhalts der destruktiven Paardynamiken (Ernst, 2020).
Die Wirksamkeit von Täterprogrammen ist sehr begrenzt und es gibt keine empirischen Befunde zu Interventionen für die verschiedenen Tätertypen (Steingen, 2020). Gruppengestützte Täterprogramme können aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen (nicht mehr als zwei Personen anwesend) aktuell ohnehin nicht durchgeführt werden.
Empfehlungen
Durch den multidimensionalen Stressor SARS-CoV-2 / COVID-19 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Allgemeinbevölkerung mit einem Anstieg insbesondere von Angsterkrankungen, Depressionen, Suiziden, Anpassungsstörungen, Traumafolgestörungen und Abhängigkeitsstörungen zu rechnen, der voraussichtlich zu einer lang dauernden Phase zunehmender Inanspruchnahme des psychiatrisch-psychotherapeutischen Versorgungssystems führen wird (Aly et al., 2020; Zielasek & Gouzoulis-Mayfrank, 2020). Auf die psychotherapeutischen und somatischen Behandlungsmöglichkeiten, die auf das Individuum gerichtet sind, kann hier aus Platzgründen nicht eingegangen werden. Entsprechende Überlegungen finden sich bei Brakemeier et al. (2020).
Bei länger andauernden Ausgangssperren und Quarantäne, so notwendig und sinnvoll diese Maßnahmen zur Eindämmung des Virus auch sein mögen (Pozo-Martin, Cristea & El Bcheraoui, 2020), ergeben sich jedoch nicht nur bei Individuen, sondern auch im familiären Bereich zahlreiche Gefahren.
An Feiertagen wie Weihnachten oder in den Ferien, wenn Familien länger auf engerem Raum zusammen sind, kann die Rate an körperlichen Übergriffen und Gewalt zunehmen. Alle einschlägigen Einrichtungen sind darum bemüht, den Betroffenen weiterhin die nötige Hilfe bereitzustellen, was aber – aufgrund von personellen Unterbesetzungen und logistischen Herausforderungen – häufig sehr schwierig ist. So ungemein notwendig solche Unterstützungseinrichtungen sind, so kommen sie bedauerlicherweise häufig erst dann zum Einsatz, wenn das Schlimmste bereits passiert ist.
Was dringend fehlt sind Interventionsformen, die zum Ziel haben, fortschreitende Eskalationen zu verhindern, d. h. rechtzeitig Wege aufzuzeigen, wie eine konstruktive Wendung erreicht werden kann. Es braucht dringend Hilfestellungen, die geeignet sind, den genannten Gefahren rechtzeitig entgegenzuwirken. Nur so wächst die Chance, Gewalttaten zu verhindern und Menschen dabei zu unterstützen, das zu leben, was Familie meint.
So hat sich z. B. gezeigt, dass das standardisierte und evaluierte Präventionsprogramm für Paare „Ein partnerschaftliches Lernprogramm“ (EPL; Engl et al., 2019; Hahlweg & Richter, 2010) nicht nur die Partnerschaftsqualität verbessert, sondern auch die Scheidungsrate und die unmittelbare biologische Stressantwort der Partner_innen auf einen Paarkonflikt hin senkt (Ditzen, Hahlweg, Fehm-Wolfsdorf, & Baucom, 2011). Idealerweise könnten Interessenten fundierte Unterstützung für eine solche persönliche Entwicklung bei Beratungsstellen und Psychotherapeut_innen finden.
In Deutschland gibt es erfreulicherweise eine flächendeckende Versorgung mit Beratungsstellen und Psychotherapeut_innen, die, was den persönlichen Kontakt anbelangt, jedoch in der aktuellen Situation ebenfalls nur eingeschränkt arbeitsfähig sind. Als Ergänzung gibt es mittlerweile ein breit gefächertes Netz von video- und internetbasierten Unterstützungsangeboten (Brakemeier et al., 2020). Doch obwohl diese sehr flexibel und von zu Hause aus genutzt werden können, haben viele Menschen noch immer eine große Hemmschwelle, sie in Anspruch zu nehmen. Insofern braucht es neue Wege, um angemessene Hilfsangebote bereitzustellen. Das Internet bietet dabei zahlreiche Möglichkeiten der Unterstützung – insbesondere in der momentanen gesellschaftlichen Situation.
Empfehlung 1: Entwicklung und Förderung von Internetplattformen, die Informationen (Tipps) zum angemessenen Umgang mit familiären Krisensituationen bereitstellen.
Diese Informationen sollten (1) wissenschaftlich fundiert und evidenzbasiert, (2) für die Betroffenen einfach und schnell zu erreichen, (3) verständliche und praxisnahe, handlungsorientierte Tipps enthalten und (4) möglichst kostenfrei sein.
Empfehlung 2: Finanzielle Förderung der Nutzung von interaktiven Online-Programmen insbesondere für finanzschwache Familien
Wenn Streitigkeiten und Konflikte bereits stark zugenommen haben, kann es sein, dass reine Informationsprogramme nicht mehr ausreichen. Dann kann ein professionelles interaktives Online-Programm helfen, die Atmosphäre wieder zu entspannen. Persönliche Kontakte mit Berater_innen oder Therapeut_innen sind dabei nicht notwendig. Es liegen mehrere wissenschaftlich fundierte und effektive interaktive Selbsthilfeprogramme vor, die den genannten Anforderungen gerecht werden und jederzeit und an jedem Ort zur Verfügung stehen (s. Kapitel 7). Da viele Menschen derzeit vermehrt zu Hause sind und das Internet noch stärker als bisher nutzen, bieten sich webbasierte Programme optimal an. Manche dieser interaktiven Selbsthilfe-Programme sind allerdings kostenpflichtig, weswegen eine Förderung insbesondere für finanzschwache Familien empfehlenswert ist.
Empfehlung 3: Aufklärungskampagnen initiieren und finanzieren
Bisher sind die oben angesprochenen Programme wenig bekannt und werden nur selten in Anspruch genommen. Es bedarf daher Initiativen zur Bekanntmachung auf kommunaler Ebene, der Ebene der Bundesländer und auf Bundesebene. Folgende Möglichkeiten einer breiten Kampagne, z. B. durch die Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung BZGA, könnten sich dafür anbieten:
- •Kampagnen mit Plakaten an öffentlichen Orten
- •Beiträge in Blogs, sozialen Medien zu wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen zur Pflege der Partnerschaft
- •Fernsehspots (vergleichbar zum „Wort zum Sonntag“ bei der ARD z. B. das „Wort zur Partnerschaft“)
- •Paarbriefe, welche Paaren von den Gemeinden zugestellt werden (vergleichbar zu Elternbriefen)
- •Broschüren für Neuverheiratete, welche auf dem Standesamt nach der Vermählung ausgegeben werden
- •Podcasts zu den Themen Partnerschaft und Familie und damit einhergehenden Herausforderungen und Problemen
- •Flyer mit der Auflistung von Angeboten, die z. B. in Arztpraxen / Gesundheitsämtern ausgelegt werden oder per Post erhältlich sind.
Empfehlung 4: Fragwürdige / schädliche Online-Programme identifizieren
Recherchen im Internet können problematisch sein, da es viele fragwürdige Angebote gibt, die nicht leicht als solche erkennbar sind (Pilsl & Heitkötter, 2020). Häufig stehen kommerzielle Interessen dahinter und Hilfesuchende werden zuerst mit kostenlosen Angeboten geködert, die sich dann als kostengebunden herausstellen. Außerdem gibt es qualitativ schlechte Angebote, die nicht wissenschaftlich fundiert sind und evtl. sogar Schaden anrichten können. Notwendig wäre es daher, dass eine unabhängige Kommission, die mit anerkannten Wissenschaftlern besetzt ist, eine nationale Liste evidenzbasierter und empfehlenswerter Programme erstellt, wie z. B. die Grüne Liste Prävention (https://www.gruene-liste-praevention.de). Die Kommission könnte z. B. beim Deutschen Jugendinstitut DJI angegliedert sein.
Hilfen für Familien
Viele Paare werden mit den durch die Pandemie verursachten Stressfaktoren zu kämpfen haben. Streit und Konflikte sind normal und gehören zum Leben dazu. In Krisenzeiten wie jetzt können Probleme und Konflikte allerdings zunehmen. Da Restaurants, Kinos, Theater, Fitnessstudios, Schulen, Kindergärten sowie Sportstätten wieder geschlossen sind, müssen Familien beziehungsweise Partner_innen auf sehr viel engerem Raum zusammen sein als sonst. Dies kann schön sein, kann aber auch zu Problemen führen oder auch Konflikte verstärken, denen man sonst aus dem Weg gehen kann.
Im Folgenden findet sich eine Zusammenstellung von Angeboten, die Möglichkeiten aufzeigen, die Paaren, Eltern und Kindern und Jugendlichen helfen können, mit den durch COVID-19 zu erwartenden Schwierigkeiten im Familienleben besser umgehen zu können – dies vor allem mit einfach umsetzbaren Hilfestellungen und Ratschlägen für den Umgang miteinander in psychisch belastenden Situationen. Während der Pandemie sind vor allem personenungebundene Angebote wichtig, da soziale Kontakte so weit wie möglich eingeschränkt werden sollten, dies gilt vor allem auch für die beratenden Professionellen.
Die Nutzung des Internets ist schon jetzt zur Normalität geworden – vor allem bei Familien mit Kindern und Jugendlichen. Grundsätzlich unterscheiden sich Online-Angebote darin, ob die Ratsuchenden selbst aktiv werden können (interaktive Webseiten) oder passiv bleiben (edukative Informationswebseiten;Pilsl & Heitkötter, 2020). Online-Angebote ohne Berater-Kontakt stellen die niederschwelligste Angebotsform dar: sie können von Ratsuchenden rasch (z. B. per Smartphone, PC, Tablet) genutzt werden; Wartezeiten bestehen nicht; sie können zu jeder Tageszeit ohne Ortsbindung in Anspruch genommen werden und sind oft nicht kostenpflichtig.
Edukative Webseiten für Familien
Hilfen für Familien
https://psychologische-coronahilfe.de/hilfen-fuer-familien/
Folgende Themen werden angesprochen:
- •Wie spreche ich mit meinem Kind über das Coronavirus?
- •Achtsamkeit in der Familie
- •Junge Kinder zu Hause während der Corona-Krise
- •24 Stunden Familie – Tipps gegen den Lagerkoller
- •Tipps bei Schlafstörungen
- •Auf einmal ist der Kindergarten zuhause – Vorschulkinder: Tipps für Eltern mit Kindern von 3 bis 6 Jahren
- •Neuer Alltag mit Säuglingen und Kleinkindern
- •Elterninfo: Suizidales Erleben und Verhalten bei Kindern und Jugendlichen
Hilfen für Erwachsene
https://psychologische-coronahilfe.de/hilfen-fuer-erwachsene/
Folgende Themen werden angesprochen:
- •Wie Sie häusliche Isolation und Quarantäne gut überstehen: Psychologische Tipps und Hilfen in einer herausfordernden Zeit
- •Gesunder Lebensstil
- •Arbeiten in Zeiten von Corona
- •Soziale Unterstützung trotz sozialer Distanzierung
- •Hände waschen, Abstand halten – Verhaltensempfehlungen einhalten
- •Risiken verstehen
- •Mir geht es gerade nicht gut – Tipps zur Förderung des subjektiven Wohlbefindens
- •Hilfe bei Lebensüberdruss
- •Übungen zu Akzeptanz und Achtsamkeit
- •Was tun gegen Schlafstörungen
- •Was tun gegen Traurigkeit und Verzweiflung? Anregungen für Erwachsene zum Umgang mit depressiven Verstimmungen
- •Tipps zum Umgang mit Einsamkeit
- •Angst, Panik und Sorgen
- •Vor lauter Sorgen spüre ich bei mir selbst schon Corona-Symptome.
- •Sorgen-Karussell durchbrechen – Was tun, wenn die Sorgen nicht mehr aufhören?
- •Umgang mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung in der Coronakrise
- •Alkohol und Drogen/Rauchen und COVID-19
- •Schwangerschaft und Corona
Ältere Menschen:
- •Pflegende Angehörige und Pflegebedürftigkeit in der Coronakrise: Probleme, Tipps und Anlaufstellen
- •Es ist gesund, negativen Altersstereotypen in der Corona-Zeit entgegenzuwirken!
- •Was tun gegen Traurigkeit und Verzweiflung?
- •Ältere Menschen: Probleme in der Corona-Krise: Ängste und Sorgen
Lehrkräfte:
- •Tipps für Lehrerinnen und Lehrer aus der Lehr-Lern-Psychologie
- •Motiviertes Lernen zu Hause anleiten: Tipps für Lehrkräfte aus der Pädagogischen Psychologie
Hilfen für Kinder- und Jugendliche
https://psychologische-coronahilfe.de/hilfen-fuer-kinder-und-jugendliche/
Folgende Themen werden angesprochen:
- •Wie motiviere ich mich beim Lernen zu Hause?
- •Schulaufgaben erfolgreich erledigen: Tipps für Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klassenstufe
- •Informationen zu Schlaf, Tag-Nacht-Rhythmus und Sorgen bei Kindern und Jugendlichen
- •Bewegung bei jungen Kindern zu Hause spielerisch fördern: Tipps für Eltern mit Kindern im Vor- und Grundschulalter
- •Effektiv zu Hause lernen –Tipps aus Sicht der Lernpsychologie
- •ADHS: Immer zappelig? Was tun?
- •Hallo Oma, ich bin so traurig und allein
- •Das zieht mich alles so runter
- •Tipps für Jugendliche gegen Depri-Stimmung
- •Selbstverletzendes Verhalten und psychische Belastungen: Hilfe in der Corona-Krise
- •Aber alle sagen doch, ich soll mir die Hände waschen: Ab wann ist das ein Zwang?
- •Is das öde – Lagerkoller-Tipps für Kinder
- •Nur noch weg hier – Tipps gegen den Lagerkoller
- •Wenn alles nur noch grau und ausweglos erscheint: Hilfen für Jugendliche
Hilfen für Eltern unter Druck in der Corona-Zeit
http://www.familienunterdruck.de/
Ziele und Inhalte: Die anhaltende Dauer von pandemiebedingten Gesundheitsrisiken und Infektionsschutzmaßnahmen werden gerade für Familien eine Herausforderung. Die Auswirkungen der Corona-Krise belasten die psychische Gesundheit von Eltern und Kindern. Viele Eltern fragen sich: Was kann ich tun, wenn mein Kind Angst hat? Wie kann ich selbst – trotz Stress und Unsicherheit – positiv bleiben? Wie kann ich den Familienalltag unter den Corona-Einschränkungen am besten gestalten? Was hilft, wenn die Nerven blank liegen? Die Homepage „Familien unter Druck“ versucht, mit zwölf kurzen Erklärvideos, in denen einfach umsetzbare Hilfestellungen und Ratschläge für den Umgang mit Kindern in psychisch belastenden Situationen Antworten zu geben. Die Videos basieren auf jahrzehntelanger Forschung führender englischer Fachleute des Londoner King’s College zu Elterntrainings sowie der Zusammenarbeit mit Eltern und Kindern und wurden für die Corona-Zeit angepasst. Feste Strukturen und Routinen im Alltag, Ideen wie eine „Familienkonferenz“ oder gemeinsame „Sorgenzeit“ umgesetzt werden kann, all das kann Eltern helfen, besser durch die herausfordernden Zeiten zu kommen. Das Projekt wird unterstützt von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) und dem Deutschen Kinderhilfswerk. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat die Schirmherrschaft über das Projekt übernommen.
Hilfe bei Paarkonflikten
https://psychologische-coronahilfe.de/beitrag/ploetzlich-staendig-zusammen-tipps-bei-paarkonflikten/
Ziele und Inhalte: Plötzlich ständig zusammen – Tipps zum Umgang mit dem Partner/der Partnerin. Streit und Konflikte sind normal und gehören zum Leben dazu. In Krisenzeiten wie jetzt können Probleme und Konflikte allerdings zunehmen, da wir belastet sind. Dadurch, dass Schulen, Kindergärten und Tagesstätten sowie Sportstätten monatelang geschlossen sind und die Kinder und Jugendlichen sich nicht untereinander treffen sollen, sind Familien auf sehr viel engerem Raum zusammen als sonst. Dies kann schön sein, aber auch zu Problemen führen oder Konflikte, denen man sonst aus dem Weg gehen kann, verstärken. Gleiches gilt für Eltern und Paare – Belastungen und gereizte Stimmung führen zur Verschärfung von Konflikten.
Die Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPS) hat eine Homepage entwickelt, in der Partner_innen viele Tipps finden können, wenn partnerschaftliche Konflikte und Auseinandersetzungen zunehmen: Folgende Themen werden behandelt:
- •Erste Hilfe: Destruktives Streiten vermeiden! Streiten Sie „richtig“!
- •Das Kind ist zu Hause: Was muss ich jetzt besonders beachten?
- •Wie erkläre ich dem Kind den Streit?
Hilfe bei häuslicher Gewalt
https://psychologische-coronahilfe.de/beitrag/haeusliche-gewalt/
Verschiedene Maßnahmen wurden vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) initiiert. Aus Sicht des Ministeriums ist es sehr wichtig, dass die Opfer die ihnen zur Verfügung stehenden Schutzmechanismen nach dem Gewaltschutzgesetz und nach den Landespolizeigesetzen kennen und nutzen, wie sie z. B. die Kontakt-, Näherungs- und Belästigungsverbote gegen die Täterinnen beantragen sowie die Wegweisung der gewalttätigen Person aus der Wohnung erwirken können. Seit Januar 2020 unterstützt der Bund mit 120 Mill. Euro den Ausbau von Frauenhäusern und anderen Hilfseinrichtungen mit dem Bundesinvestitionsprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“.
Da der Anstieg von eskalierenden Konflikten in der Familie auch dadurch bedingt sein kann, dass viele Familien aufgrund der Corona-Epidemie (Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Einkommensverluste) existenzielle materielle Sorgen haben bzw. haben werden, sollen Frauen und Familien in dieser Zeit besser unterstützt werden. Deshalb wurde der Kinderzuschlag angepasst und vom 1. April bis zum 30. September 2020 zu einem Notfall-KiZ umgebaut. Der Kinderzuschlag unterstützt Familien mit kleinen Einkommen mit bis zu 185 Euro monatlich pro Kind zusätzlich zum Kindergeld. Als kleines Einkommen gilt beispielsweise für eine Paarfamilie mit zwei Kindern ein Einkommen von ca. 1.400 bis 2.400 Euro netto bei mittleren Wohnkosten. Eltern können mit dem KiZ-Lotsen prüfen, ob sie die Voraussetzungen erfüllen, siehe: https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse.
Für Opfer häuslicher Gewalt steht das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter der kostenfreien Nummer 08000 116 016 zur Verfügung und leistet Erst- und Krisenunterstützung rund um die Uhr und dies anonym, barrierefrei und in insgesamt 18 Sprachen. Das Hilfetelefon ist auch online zu erreichen unter www.hilfetelefon.de.
Allerdings könnte es unter den Corona-Bedingungen für gefährdete Frauen schwierig sein, telefonische Hilfen in Anspruch zu nehmen. Die Täter sind häufig unter Homeoffice-Bedingungen die ganze Zeit in der Wohnung und kontrollieren ihre Partner_nnen stark, um zu verhindern, dass sie Hilfe anfordern. So sind unbemerkte, geschweige denn ungestörte Telefonate kaum möglich.
Personen, die häusliche Gewalt (Partnergewalt) erleben, können aufgrund der derzeitigen Situation noch stärker bedroht und gefährdet sein als sonst. Schon vor dieser Krisenzeit war Partnergewalt z. B. in Form von körperlicher oder sexueller Gewalt, psychologischem / emotionalem Missbrauch oder Stalking sehr häufig. Schätzungen besagen, dass 22 – 35 % der Frauen und 7 – 29 % der Männer Partnergewalt erfahren haben (WHO, 2013). Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen bedeuten, dass weniger Kontakt zu einem potentiell unterstützenden Umfeld besteht, Hilfsangebote schwerer aufzusuchen sind und mehr Zeit im Haushalt mit dem Täter verbracht wird. Räumliche Enge und erhöhter Stress können Aggressivität weiter steigern. Trotz dieser besonders schwierigen Situation ist es wichtig, dass es auch im Moment Hilfsangebote, Beratung (auch anonym) und Auswege gibt. Auf der Website werden direkt Kontaktdaten zu Hilfsangeboten zur Verfügung gestellt, u. a. zur Polizei, telefonischen Beratungsangeboten, der Telefonseelsorge und Online-Beratungsangeboten.
Bei einer akut bedrohlichen Situation:
- •Polizei-Notruf unter 110, – Feuerwehr / Rettungsdienst / Notarzt: 112
- •Kostenlose telefonische Beratung und Hilfe: Hilfetelefon bei Gewalt gegen Frauen in 17 Sprachen (rund um die Uhr): 08000 116 016
- •Telefonseelsorge: 116 123
- •Opfer-Telefon des Weissen Rings (7 – 22 Uhr): 116 006
Online-Beratung
- •Sofortchat (ohne Anmeldung) zwischen 12 – 20 Uhr, Terminchat und E-Mail-Beratung über das Hilfetelefon bei Gewalt gegen Frauen:
- •
- •Beratung per Chat oder E-Mail der Telefonseelsorge: https://online.telefonseelsorge.de/ Opferberatung durch die Polizei:
- •
Wenn Personen Angst haben, selbst gewalttätig zu werden. Wenn Sie bemerken, dass Sie selbst Ihre Wut und Aggressionen nur noch schwer kontrollieren können oder Sie körperliche Übergriffe gegenüber Ihrem Partner/Ihrer Partnerin begangen haben, holen Sie sich umgehend Hilfe:
- •Bundesweite kostenfreie Hotline der Behandlungsinitiative Opferschutz (BIOS-BW) e.V., Montags bis Freitags 9 – 18 Uhr: 0800 70 222 40
- •
- •Für Männer, die in Krisensituationen nicht die Beherrschung verlieren möchten (mehrsprachig):
- •
Hilfen für Kinder
- •Kinder, die häusliche Gewalt miterleben, können die Nummer gegen Kummer anrufen: Montag-Samstag, 14 – 20 Uhr, 0800 111 0333
- •Online Chat oder Mailberatung: https://www.nummergegenkummer.de/
Selbsthilfematerialien
Bücher und DVDs.
Auch mit entsprechenden Materialien können wissenschaftliche Informationen verbreitet und Impulse für Paare gegeben werden, die ihre Beziehung verbessern wollen. Dabei werden unterschiedliche und kostengünstige Medientechnologien verwendet, um auch Paare zu erreichen, die keinen direkten Kontakt zu professionellen Hilfesystemen wünschen. Hierunter fallen Selbsthilfematerialien, wie Bücher (z. B. Bodenmann, 2007; Engl & Thurmaier, 2012; Schindler, Hahlweg & Revenstorf, 2020) und interaktive DVDs.
Beispiele für interaktive DVDs im deutschen Sprachraum sind „Glücklich trotz Alltagsstress“ (Bodenmann et al., 2014) und die Reihe „Gelungene Kommunikation…damit die Liebe bleibt“ für junge Paare, Eltern und Paare im (Un–) Ruhestand (Engl & Thurmaier, 2007, 2010, 2012). Diese Reihe wurde vom Bayerischen Sozialministerium finanziert und kostet je DVD samt umfangreicher Begleitbroschüre 10.– € (erhältlich über www.institutkom.de).
Webbasierte interaktive Selbsthilfe-Programme
Die Nutzung des Internets ist heute zum festen Bestandteil im privaten wie im beruflichen Alltag geworden. Das Internet bietet zahlreiche Möglichkeiten der Unterstützung – insbesondere in der momentanen gesellschaftlichen Situation. Wer seine Beziehung bewusst stärken möchte, kann dies mithilfe eines professionellen Online-Programms tun. Persönliche Kontakte sind dabei nicht notwendig. Online-Programme dieser Art können vom Nutzer unabhängig von Zeit und Ort am PC (bzw. Notebook / Tablet / Smartphone) bearbeitet werden. Es liegen mehrere wissenschaftlich fundierte interaktive Selbsthilfeprogramme vor.
Deutschsprachige webbasierte Programme zur Stärkung der Paarbeziehung
PaarBalance (https://www.paarbalance.de/)
Entwickelt von Prof. Dr. Ludwig Schindler und Dr. Judith Gastner.
Nach der Erstellung eines individuellen Beziehungsprofils (Stärken & Herausforderungen) werden die wichtigsten ‚Zutaten‘ für eine dauerhaft gelingende Beziehungsgestaltung anhand von Videos, interaktiven Übungen, praktischen Anwendungsvorschlägen vermittelt. Es gibt zahlreiche Motivationshilfen (Stimmungsbarometer, Beziehungs-Chronik, Nachrichten etc.). Themen sind u. a.: Geben und Nehmen, Wir-Gefühl, Einstellungen, Kommunikationsfertigkeiten, Konfliktlöse- und Deeskalationsstrategien, Unterstützung bei Stress, Selbstfürsorge, erfüllte Sexualität. Zugeschnitten auf den / die einzelne Partner_in; der bzw. die andere kann zu jedem Zeitpunkt einbezogen werden. Effektivitätsnachweise liegen vor (Keller et al., 2021). Das Programm ist kostenpflichtig; finanziell schwächer gestellte Paare erhalten einen Sozialrabatt.
Paarlife online (https://www.paarlife.ch/)
Entwickelt von Prof. Dr. Guy Bodenmann (Universität Zürich).
Inhalte sind: Förderung der partnerschaftlichen Kommunikation und Steigerung der gegenseitigen Unterstützung in Zeiten von Stress. Theoretischer Input, Vertiefung mittels Quiz und diagnostischer Übungen (Selbstevaluation, Partnerevaluation), Anleitungen zu praktischen Übungen mit Videobeispielen. Das Programm kann allein oder zu zweit durchgeführt werden. Es ist kostenfrei, wenn man der Begleitforschung zustimmt. Die Effektivität wird derzeit wissenschaftlich überprüft.
PAARADIES APP (www.damit-die-liebe-bleibt.de)
Entwickelt von Dr. Joachim Engl & Dr. Sandra Hensel (Institut für Kommunikationsforschung, München). Im Mittelpunkt der App steht der partnerschaftliche Umgang miteinander. Mit ihren zahlreichen Funktionen, wie
- •der Erfassung eines Stimmungsbarometers (jeweils die eigene Stimmung festhalten und für die Partner_innen sichtbar machen),
- •Anregungen Komplimente zu machen (Zuneigung zum Ausdruck bringen, z. B. sich gegenseitig öfter etwas Nettes schicken),
- •verschiedenen Aufgaben (z. B., Anregungen für mehr wertvolle Zeit zu zweit, Planen von gemeinsame Aktivitäten und Gesprächen) und Hilfestellungen, Konflikte besser zu lösen (z. B. mit Hilfe von angeleiteten, kurzen Fragen eine konstruktive und verständliche Mitteilung formulieren)
- •soll sie Paare dazu animieren, regelmäßig Zeit in gelungene Gespräche zu investieren und die Paarkommunikation zu verbessern. Die App wird zur Zeit wissenschaftlich auf ihre Effektivität untersucht. Sie kann kostenfrei im Google Play Store oder Apple App Store heruntergeladen werden.
Deutschsprachige Online-Programme zur Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz
Triple P Online https://www.triplep-eltern.de/de-de/unterstuetzung-finden/triple-p-online/
Dieser Online-Elternkurs besteht aus 8 Modulen à ca. 30 – 60 Minuten mit Videoausschnitten, interaktiven Übungen und Downloadmöglichkeit allgemeiner sowie personalisierter Materialien. Triple P Online ist gut geeignet für Eltern, die aufgrund mangelnder Zeit, zu weiter Entfernung oder anderer Hindernisse nicht persönlich an Elternangeboten teilnehmen können oder wollen. Das Programm ist in unterschiedlichen Sprachen verfügbar und kann von Eltern sowohl mit als auch ohne professionelle Unterstützung bearbeitet werden.
Studien von Sanders et al. (2012) und Day und Sanders (2018) zeigten, dass Eltern, die am Triple P Online teilnahmen, auch sechs Monate später signifikante Verbesserungen berichteten: eine Reduktion des kindlichen Problemverhaltens und ihres dysfunktionalen elterlichen Erziehungsverhaltens, ein gesteigertes Vertrauen in ihre Elternrolle und eine Verminderung ihrer elterlichen Ärgerreaktionen. Ihre Zufriedenheit mit dem Programm war hoch.
Für Kommunen gibt es die Möglichkeit, eine eigene Internetseite einzurichten, über die das Programm für Eltern frei zugänglich ist. Eltern können das Programm aber auch jederzeit über die allgemeine Triple P-Elternseite (https://www.triplep-eltern.de) erreichen. Um speziell die positive Beziehung zum Kind zu fördern, empfiehlt sich außerdem die Webseite. https://www.positiv-elternsein.de/positiv-elternsein-in-unsicheren-zeiten
Literatur
(2020). Die COVID-19-Pandemie veränderte nicht die Zahl, aber die Art psychiatrischer Notfälle. Versorgungsdaten aus Vergleichszeiträumen von 2019 und 2020, Nervenarzt, 91, 1047 – 1049., https://doi.org/10.1007/s00115-020-00973-2
(2020). Couples’ relationships in the age of COVID-19. World Confederation of Cognitive and Behavioral Therapies. https://www.wccbt.org/Downloads/WCCBT_e-News_Sept-2020.pdf
(2020). Familie heute. Daten. Fakten. Trends. Familienreport 2020. Berlin: BMFSFJ.
(2007). Stress und Partnerschaft. Gemeinsam den Alltag bewältigen (4. Auflage). Bern: Huber.
(2014). Enhancement of couples’ communication and dyadic coping by a self-directed approach: A randomized controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 82, 580 – 591.
(2020). COVID-19-Pandemie: Belastungen des medizinischen Personals – Ein kurzer aktueller Review. Psychiatrische Praxis, 47, 190 – 197. https://doi.org/10.1055/a-1159-5551
(2020). Die COVID-19-Pandemie als Herausforderung für die psychische Gesundheit: Erkenntnisse und Implikationen für die Forschung und Praxis aus Sicht der Klinischen Psychologie und Psychotherapie. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 49, 1 – 31. https://doi.org/10.1026/1616-3443/a000574
(2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. The Lancet, 395, 912 – 920. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8
(2013). The Great Recession and the risk for child maltreatment. Child Abuse & Neglect, 37, 721 – 729. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.08.004
(2020). Partnerschaftsgewalt. Kriminalstatistische Auswertung – Berichtsjahr 2019. Wiesbaden: Bundeskriminalamt.
(2020). Missbrauchszahlen. Zugriff am 01. 05. 2020. Verfügbar unter: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/missbrauchszahlen-1752038
(2020). An increasing risk of family violence during the Covid-19 pandemic: Strengthening community collaborations to save lives. Forensic Science International: Reports, 2, 100089. https://doi.org/10.1016/j.fsir.2020.100089
(2020). Parenting in a time of COVID-19. Lancet, 395 (10231),
e64 . https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30736-4(2010). Marital conflict and children: An emotional security perspective. New York: Guilford Press.
(2020). Psychologische Corona-Hilfe. Verfügbar unter: https://psychologische-coronahilfe.de/hilfen-fuer-familien/.
(2018). Do parents benefit from help when completing a self-guided parenting program online? A randomized controlled trial comparing Triple P Online with and without telephone support. Behaviour Therapy, 49, 1020 – 1038. https://doi.org/10.1016/j.beth.2018.3.002
(2019). Intimacy as related to cortisol reactivity and recovery in couples undergoing psychosocial stress. Psychosomatic Medicine, 81 (1), 16 – 25.
(2011). Assisting couples to develop healthy relationships: Effects of couples relationship education on cortisol. Psychoneuroendocrinology, 36, 597 – 607. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2010.07.019 [Epub 2010].
(2014). Psychobiology of social support: The social dimension of stress buffering. Restorative Neurology Neuroscience, 32, 149 – 162.
(2019). Oxytocin for learning calm and safety. International Journal Psychophysiology, 136, 5 – 14. https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2018.06.004
(2007). 1) Ein Kick mehr Partnerschaft. Gelungene Kommunikation… damit die Liebe bleibt. Eine interaktive DVD zum Gelingen von Beziehungen für junge Paare mit Begleitbroschüre. 2) Eine interaktive DVD für Paare in mehrjähriger Beziehung (2010). 3) Eine interaktive DVD für Paare im (Un–) Ruhestand (2012). München: Institut für Forschung und Ausbildung in Kommunikationstherapie.
(2012). Wie redest Du mit mir? Fehler und Möglichkeiten in der Paarkommunikation. Freiburg: Kreuz.
(2019). Prävention von Scheidung: Ergebnisse einer 25-Jahres Follow-up Studie. Verhaltenstherapie, 29, 85 – 96. https://doi.org/10.1159/000489094
(2020).
Aufgaben und rechtliche Aspekte von Polizei, Staatsanwaltschaft und Strafrecht, Jugendamt, Jugendhilfe, Familiengericht und Frauenhäuser . In A. Steigen (Hrg.), Häusliche Gewalt. Handbuch der Täterarbeit. (S. 103 – 128). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.(2021). Verfügbar unter: https://www.diw.de/de/diw_01.c.809410.de/familienmonitor_corona.html
(2020). Kinderschutz ist systemrelevant – gerade in Zeiten der SARS-CoV-2-Pandemie. DIJuF: Forum für Fachfragen. Zugriff am 07. 07. 2020. Verfügbar unter: https://www.dijuf.de/coronavirus-materialpool.html
(2021). Impact of the COVID-19 pandemic on parent, child, and family functioning [Online]. Family Process. https://doi.org/10.1111/famp.12649
(2019). The Great Recession and mental health in the United States. Clinical Psychological Science, 7, 900 – 913. https://doi.org/10.1177/2167702619859337.
(2016). The Great Recession and employee alcohol use: A U.S. population study. Psychology of Addictive Behaviors, 30, 158 – 167. https://doi.org/10.1037/adb0000143
(2020). Mental health and Clinical Psychological Science in the time of COVID-19: Challences, opportunities, and a call to action. American Psychologist [online first] https://doi.org/10.1037/amp0000707
(2020). Alkohol und Rauchen: Die COVID-19-Pandemie als idealer Nährboden für Süchte. Deutsches Ärzteblatt, 117 (25), A-1251 / B-1060.
(2008). Körperliche Bestrafung: Prävalenz und Einfluss auf die psychische Entwicklung bei Vorschulkindern. Kindheit und Entwicklung, 17, 46 – 56.
(2010). Prevention of marital instability and distress. Results of an 11-year longitudinal follow-up study. Behaviour Research Therapy, 48, 377 – 83. https://doi.org/10.1016/j.brat.2009.12.010
(2020). The virus changed everything, didn’t it? Couples’ division of housework and childcare before and during the Corona crisis. Journal of Family Research, 33 (1), 99 – 114. https://doi.org/10.20377/jfr-488
(2010). Social relationships and mortality risk: A meta-analytic review. PLOS Medicine, 7 (7),
e1000316 .(2000). A typology of men who are violent toward their female partners: Making sense of the heterogeneity in husband violence. Current Directions in Psychological Science, 9 (4), 140 – 143. https://doi.org/10.1111/1467-8721.00079
(2021). [COVID- and Social Distancing Related Worries and their Relationship to Mental and Physical Illness]. Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie, 71 (2), 57 – 60. https://doi.org/10.1055/a-1347-7393
(2014). Twelve-month prevalence, comorbidity and correlates of mental disorders in Germany: The mental health module of the German Health Interview and Examination Survey for Adults (DEGS1-MH). International Journal of Methods in Psychiatric Research, 23, 304 – 319. https://doi.org/10.1002/mpr.1439
(2021). Efficacy of the web-based PaarBalance program on relationship satisfaction, depression and anxiety – A randomized controlled trial. Internet Interventions, 23, 100360. https://doi.org/10.1016/j.invent.2020.100360
(2018). Psychische Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Querschnittergebnisse aus KiGGS Welle 2 und Trends. Journal of Health Monitoring, 3 (3), 37 – 45. https://doi.org/10.17886/RKIGBE2018077
(2020). Kindsein in Zeiten von Corona. Erste Ergebnisse zum veränderten Alltag und zum Wohlbefinden von Kindern. München: Deutsches Jugend Institut DJI. https://www.dji.de/veroeffentlichungen/aktuelles/news/article/758
(2020). Coronavirus-Pandemie – Die Krise nachhaltig überwinden. 3. Ad-hoc Stellungnahme. Zugriff am 03. 07. 2020. Verfügbar unter: https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_04_13_Coronavirus-Pandemie-Die_Krise_nachhaltig_%C3%BCberwinden_final.pdf
(2020). The prevalence and influencing factors in anxiety in medical workers fighting COVID-19 in China: A cross-sectional survey. Epidemiology and Infection, 148,
e98 . https://doi.org/10.1017/S0950268820001107(2020). Factors associated with depression, anxiety, and PTSD symptomatology during the COVID-19 pandemic: Clinical implications for U.S. young adult mental health. Psychiatry Research, 290, 113172. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113172
(2020). Thüringer Familien in Zeiten von Corona –Wohlbefinden der Kinder, Herausforderungen des Homeschooling & Unterstützungsbedarfe der Eltern. Erste Befunde. 25. April 2020. Zugriff am 07. 07. 2020. https://www.dksb.de/fileadmin/user_upload/20-04-25_Befr.Familien-1.Befunde.pdf
(2020). Romantic relationship conflict due to the COVID-19 pandemic and changes in intimate and sexual behaviors in a nationally representative sample of American adults. Journal of Sex and Marital Therapy. https://doi.org/10.1080/0092623X.2020.1810185
(2020). Applying relationship science to evaluate how the COVID-19 pandemic may impact couples’ relationships. American Psychologist. https://doi.org/10.1037/amp0000714
(2020). Bestandsaufnahme Online-Paarberatung. München: Deutsches Jugendinstitut.
(2020). Mental health before and during the COVID-19 pandemic: a longitudinal probability sample survey of the UK population. The Lancet Psychiatry. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30308-4.
(2020). Rapid Review der Wirksamkeit nicht-pharmazeutischer Interventionen bei der Kontrolle der COVID-19-Pandemie, Robert Koch-Institut, 28. 9. 20201. Verfügbar unter: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/Rapid-Review-NPIs.pdf?
(2020). Risk and resilience in family well-being during the COVID-19 Pandemic. American Psychologist [Advance online publication] https://doi.org/10.1037/amp0000660
(2020). Mental health and quality of life in children and adolescents during the COVID-19 pandemic—results of the COPSY study. Deutsches Ärzteblatt, 117, 828 – 9. https://doi.org/10.3238/arztebl.2020.0828
(2014). Marital quality and health: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 140 (1), 140 – 187.
(2012). A randomized controlled trial evaluating the efficacy of Triple P Online with parents of children with early-onset conduct problems. Behaviour Research Therapy, 50, 675 – 84. https://doi.org/10.1016/j.brat.2012.07.004
(2020). Partnerschaftsprobleme: So gelingt Ihre Beziehung. Handbuch für Paare (6., überarbeitete Auflage). Heidelberg: Springer.
(2020). Changes in employment and relationship satisfaction in times of the COVID-19 pandemic: Evidence from the German Family Panel. European Societies [online first 30. 10. 2020], 1 – 16. https://doi.org/10.1080/14616696.14612020.11836385
(2016). Intimate partner violence in the Great Recession. Demography, 53, 471 – 505. https://doi.org/10.1007/s13524-016-0462-1
(Hrsg.). (2020). Häusliche Gewalt. Handbuch der Täterarbeit. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
(2020). Corona-Krise. Nicht alles ist schlecht. Statista. Zugriff am 07. 07. 2020. Verfügbar unter. https://de.statista.com/infografik/21755/umfrage-zu-positiven-aspekten-der-corona-krise/
(2020). Der longitudinale Zusammenhang von Coparenting, Beziehungsqualität und kindlichen psychischen Störungen. Ergebnisse eines 10-Jahres-Follow-up. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie. https://doi.org/10.1026/1616-3443/a000576
(2020). Die Pandomie als psychologische Herausforderung. Ansätze für ein psychologisches Krisenmanagement. Gießen: Psychosozial-Verlag.
(2010). The association between coparenting and child adjustment: A meta-analysis. Parenting: Science and Practice, 10, 286 – 307.
(2021). Young children’s and parents’ mental health during the COVID-19 Pandemic. University of Bochum. Manuscript submitted for publication.
(2017).
Familiale Sozialisation und Erziehung . In H.-W. BierhoffD. Frey (Hrsg.), Kommunikation, Interaktion und soziale Gruppenprozesse (Enzyklopädie der Psychologie. Themenbereich C Theorie und Forschung. Serie VI Sozialpsychologie. Band 3, S. 213 – 242). Göttingen: Hogrefe.(2020). Constructive and destructive interparental conflict, problematic parenting practices, and children’s symptoms of psychopathology. Journal of Family Psychology, 34, 301 – 311.
(2020). Child, parent, and family mental health and functioning in Australia during COVID-19: Comparison to pre-pandemic data [preprint]. Developmental Psychology, Special Call ’Parenting and Family Dynamics in Times of COVID-19, 30 – 09 – 2020. Verfügbar unter: https://psyarxiv.com/ydrm9/
(2020). Bundesweite Elternbefragung zu Homeschooling während der Covid 19-Pandemie. Erkenntnisse zur Umsetzung des Homeschoolings in Deutschland. Verfügbar unter: https://www.zepf.eu/wp-content/uploads/2020/06/Bericht_HOMEschooling2020.pdf
(2013). Global and regional estimates of violence against women. Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. Genf: WHO.
(2020). Gute Partnerschaft gleich gutes Erziehungsteam? Kindheit und Entwicklung, 29, 5 – 20. https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000296
(2020). COVD-19-Pandemie: Psychische Störungen werden zunehmen. Deutsches Ärzteblatt, 228 (21), A-1114.