Zur Rolle und Bedeutung der Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie (KJPPP) in den geplanten nationalen Gesundheitszentren
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat am 6. September 2018 die Gründung von zwei neuen Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung angekündigt, zu denen die Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie (KJPPP) wesentlich beitragen kann. Mit beiden Zentren sollen Volkskrankheiten adressiert werden, die regelhaft ihren Beginn in Kindheit und Jugend haben, einen chronischen Verlauf nehmen und in lebenslange psychosoziale Behinderung einmünden können.
Warum sind die beiden neuen Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung notwendig?
Die Aufgaben und Ziele der beiden neuen Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung wurden in der Pressemitteilung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (Bundesministerium, 2018) grob skizziert. Im Fokus der Förderlinie der Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung steht die Verbesserung von Prävention, Diagnostik, Therapie und Versorgung von häufigen, chronischen Volkskrankheiten. Hierbei werden in der aktuellen Pressemitteilung psychische Erkrankungen prominent genannt, insbesondere Verhaltensstörungen, Angststörungen und Depression.
Häufigkeiten und früher Beginn psychischer Erkrankungen
Psychische Erkrankungen sind mindestens so häufig wie andere Volkskrankheiten, unterscheiden sich aber von diesen durch die regelhaft frühe Manifestation erster Symptome, so dass in hohem Maße Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene betroffen sind, mit erheblichen langfristigen negativen Auswirkungen auf die individuelle soziale, schulische und berufliche Entwicklung sowie auf ihre Familienangehörigen. Psychische Erkrankungen sind nach Untersuchungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Europäischen Union (EU) die gesellschaftlich belastendsten aller Krankheitsgruppen (Wittchen et al., 2011; European Commission, 2013; World Health Organziation, 2004; European Commission, 2015). Das Belastungsausmaß bestimmt sich aus der hohen Prävalenz (jeder zweite Bundesbürger erkrankt im Laufe des Lebens), ihrem zumeist frühen Beginn im Kindes und Jugendalter (drei von vier beginnen vor dem 24. Lebensjahr) und dem – unbehandelt – meist chronischen Verlauf verbunden mit krankheitsbedingten Behinderungen und Einschränkungen (Davis, 2013; Whiteford et al., 2015). Auch in Deutschland lässt sich analog zu internationalen Trends bei Kindern und Jugendlichen eine zunehmende Verschiebung der Morbidität von somatischen hin zu psychischen Erkrankungen nachweisen (Schlack et al., 2008; Palfrey et al., 2005). Etwa ein Fünftel aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland zeigen in Fragebogen-basierten repräsentativen Erhebungen Symptome psychischer Erkrankungen in Form von emotionalen und Verhaltensproblemen (Hölling et al., 2007; Hölling et al., 2014; Baumgarten, 2018). Auch klinisch-epidemiologische Studien belegen seit über 20 Jahren, dass mehr als 20 % aller Kinder und Jugendlichen unter Angsterkrankungen, Depressionen und Suchterkrankungen leiden. Insbesondere die Prävalenz affektiver Erkrankungen und Suchterkrankungen im Zusammenhang mit digitalen Medien scheint international zuzunehmen (Mojtabai et al., 2016). Etwa 10 % aller Jungen und bis zu 20 % aller Mädchen in Deutschland berichten von Suizidgedanken, durchleben suizidale Krisen oder begehen einen Suizidversuch (Beesdo-Baum et al., 2015; Brunner et al., 2007; Kaess et al., 2011a; Kaess et al., 2011b).
Dennoch bleiben auch in Deutschland mindestens die Hälfte aller Menschen mit psychischen Erkrankungen über die Lebensspanne vom Gesundheitssystem unbehandelt (Wittchen et al., 2011). Nur jedes fünfte bis zehnte betroffene Kind in Deutschland hat bei Manifestation der Symptomatik innerhalb von 12 Monaten Kontakt zu einem Therapeuten (Wölfle et al., 2014). Die Behandlungsverzöger- ung nach Erstmanifestation liegt nach Daten der WHO in Deutschland beispielsweise für affektive Erkrankungen bei 2 Jahren (Wittchen et al., 2011; Christiana et al., 2000; Wang et al., 2007). Damit erfolgen erste fachspezifische Behandlungen zumeist erst dann, wenn sich komorbide Erkrankungen manifestiert haben, die soziale Desintegration weit fortgeschritten ist und sich eine Chronifizierung eingestellt hat.
Psychische Erkrankungen verursachen in Europa 11–27 % der gesamten Gesundheitskosten, die zusätzlichen indirekten Kosten betragen ein Vielfaches (European Commission, 2013a; European Commission 2013b, Gustavsson et al., 2011). Die WHO betont in ihren Prognosen daher die zunehmende und besondere Bedeutung psychischer Erkrankungen für die Gesundheit der Bevölkerung und die damit verbundenen Kosten für die sozialen Sicherungssysteme (World Health Organziation, 2004).
Alterstypische Entwicklungsverläufe psychischer Erkrankungen und Risiken
Pathophysiologische und therapeutische Erkenntnisse, die an Erwachsenen gewonnen wurden, können keineswegs generell auf Kinder übertragen werden. Vielmehr ist es unumgänglich, die komplexen pathophysiologischen Krankheitsprozesse in jenen frühen Entwicklungsphasen mehrdimensional zu untersuchen, um die Wirksamkeit entwicklungs- und milieuspezifischen Therapien und Behandlungsformen deutlich zu verbessern.
Psychische Erkrankungen zeigen altersspezifische Auftretenswahrscheinlichkeiten und über die Lebensspanne stark altersabhängige phänotypische Ausprägungen. Während Entwicklungsstörungen wie Autismus-Spektrum-Störungen, Sprech- und Sprachstörungen, motorische Entwicklungsstörungen oder Intelligenzminderung ab Geburt und frühem Kindesalter bestehen und eine hohe Persistenz aufweisen, werden andere Krankheitsbilder wie z. B. Angst, Depression, ADHS, Sozialverhaltensstörung, schulische Entwicklungsstörungen zumeist im Laufe des Kindesalters inzident, andere wiederum mehrheitlich in der Adoleszenz, wie z. B. Essstörungen, Substanzabusus. In der Adoleszenz zeigen sich zudem prodromale Auffälligkeiten schizophrener Psychosen im Denken, im Affekt und im Verhalten, die sich typischerweise erst im jungen Erwachsenenalter in voller Ausprägung manifestieren (vgl. Abbildung 1).
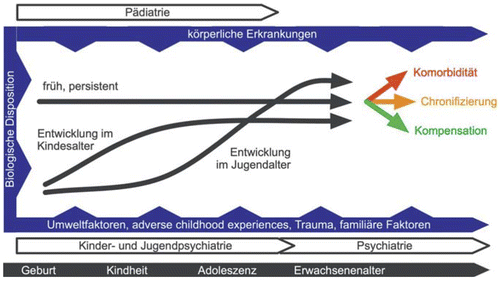
Das Kindes- und Jugendalter ist zudem für die Hirnreifung eine besonders kritische Phase. Störungen einer regelrechten kognitiven, sozialen und emotionalen neuronalen Entwicklung durch dysfunktionale und beeinträchtigende Familienmuster, traumatische Erlebnisse oder Vernachlässigung der basalen Bedürfnisse (sog. „adverse childhood experiences“) können über die gesamte Lebensspanne das Risiko sowohl für eine Ersterkrankung als auch für besonders schwere Erkrankungsmuster entscheidend erhöhen. Die neuere Forschung hat inzwischen die besonders kritischen, spezifischen neurobiologischen sowie psychosozialen Entwicklungsphasen im Kindes- und Jugendalter identifiziert, die als „kritische Zeitfenster“ gelten. In diesen können die Weichen entscheidend dafür gestellt werden, ob es zu einer lebenslangen „Anfälligkeit“ (= Vulnerabilität) für psychische Erkrankungen und einen malignen Verlauf kommt oder aber ob Resilienz erhöht wird und Kompensation gelingt (vgl. Abbildung 2). So stellen beispielsweise die Einschulung oder ein Schulwechsel, die Pubertät, aber ebenso die Phase der verlängerten Adoleszenz ins junge Erwachsenenalter (emerging adulthood) besondere Herausforderungen dar, die mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko einhergehen (Fegert, 2016).
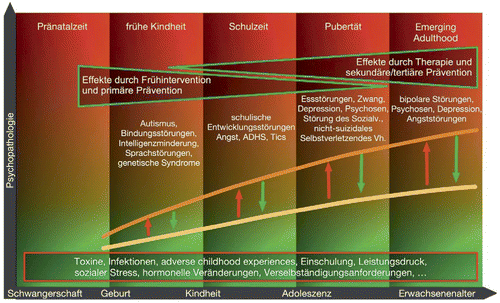
Wenn sich eine psychische Erkrankung im Kindes- und Jugendalter einmal manifestiert hat, erhöht sich das Risiko für die Entwicklung komorbider psychischer Erkrankungen, aber ebenso konsekutiver somatischer Erkrankungen erheblich. Chronische somatische Erkrankungen wiederum gehen mit hohen Raten psychischer Belastungen einher, und die Komorbidität somatischer und psychischer Erkrankungen verkompliziert Verlauf und Therapie (Haro et al., 2014).
Wenn auch die komplexen und heterogenen Trajektorien psychischer Erkrankungen (siehe Abbildung 1 und 2) zwischenzeitlich besser verstanden sind, so gilt dies keineswegs für deren Determinanten. Daher lassen sich die klinischen Verläufe (einschließlich des Auftretens komorbider Erkrankungen), das differentielle Ansprechen auf verschiedene therapeutische Interventionen und resultierende Behandlungsergebnisse derzeit kaum prädizieren. Zwar hat die moderne Forschung viele, grundsätzlich effektive Therapieverfahren verfügbar gemacht. Welche dieser Verfahren bei welchem Patienten mit welchen Vulnerabilitäten zu welchem Zeitpunkt die beste und geeignetste ist, bleibt jedoch eine unbeantwortete Frage. In unzureichender Kenntnis der spezifischen Risikosignaturen und infolge des Mangels an entsprechenden randomisiert-kontrollierten Interventionsstudien können die gegenwärtigen Therapien und Präventionsmaßnahmen nur bedingt risiko- und bedarfsangemessen adaptiert werden.
Zudem sind Kinder und Jugendliche angesichts des breiten off-label Gebrauchs von Psychopharmaka im Kindes- und Jugendalter und aufgrund entwicklungsspezifischer Besonderheiten der Pharmakokinetik und Pharmakodynamik besonderen Risiken ausgesetzt. Nichtsdestotrotz besteht die fachliche und ethische Erfordernis, effektive pharmakologische sowie nicht-pharmakologische Therapieansätze allen Altersstufen in der erforderlichen Breite anzubieten und zugänglich zu machen. Eine verstärkte Forschung zu Interventionen im Entwicklungsverlauf, um spätere Erkrankungen zu verhindern, bedarf auch einer entwicklungsbezogenen ethischen Diskussion zur Forschung an (noch) gesunden Kindern und Jugendlichen mit entsprechenden Risikomerkmalen.
Somit bleiben trotz intensiver Bemühungen der letzten Jahrzehnte die meisten psychischen Erkrankungen weiterhin therapeutisch insuffizient versorgt.
Besseres Verständnis der Ursachen psychischer Erkrankungen
Zur Verbesserung der therapeutischen Optionen ist die Kenntnis der disponierenden und auslösenden Bedingungen und der pathophysiologischen Mechanismen essentiell. Die Ursachen psychischer Erkrankungen sind im Zusammenspiel zwischen erblicher Disposition, neurobiologischer Manifestation und modifizierender Umwelt begründet (vgl. Abbildung 1). Belastende Kindheitsereignisse (adverse childhood experiences) wie Misshandlung, sexueller Missbrauch und Vernachlässigung betreffen etwa ein Drittel der deutschen Bevölkerung. Die WHO geht davon aus das 90 % der Fälle im Gesundheitswesen nicht adäquat wahrgenommen und behandelt werden. Deshalb hat die Weltgemeinschaft neben dem Nachhaltigkeitsziel zur Gesundheit (sustainable development goal 3, SDG 3) auch ein spezifisches Ziel in Bezug auf gewaltfreies Aufwachsen von Kindern (SDG 16.2) und entsprechende Indikatoren beschlossen (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 2018). Solche frühen Belastungen haben erhebliche Langzeitwirkungen in der körperlichen und seelischen Gesundheit (Clemens et al., 2018).
Die spezifische Ätiologie und die kausalen Mechanismen von Entstehung und Aufrechterhaltung der jeweiligen psychischen Erkrankungen sind jedoch weitgehend unklar. Den erheblichen technischen und methodischen Fortschritten im Bereich der Bildgebung, Neuropsychologie, Neurophysiologie, Genetik und Epigenetik hinsichtlich der Identifikation der (neuro-)biologischen Korrelate der psychischen Erkrankungen steht auf der Ergebnisseite weiterhin im hohen Maße die oft fehlende Spezifität dieser Merkmale entgegen. Daher fehlen nach wie vor klinisch anwendbare Biomarker, welche die frühzeitige Identifikation von Entwicklungsstörungen verbessern können und für frühe Interventionsstrategien nutzbar wären. Dies liegt u. a. darin begründet, dass psychische Erkrankungen in den diagnostischen Klassifikationssystemen primär aufgrund der klinischen Symptomatik definiert werden. Dieses diagnostische Vorgehen vernachlässigt die erhebliche multifaktorielle und heterogene Ätiologie und Pathogenese der Erkrankungen. Diesem Gedanken folgend fanden in den letzten Jahren zunehmend dimensionale transdiagnostische Mehrebenenansätze in der Forschung Eingang (research domain criteria) (National Institute of Mental Health, 2018).
Die Ankündigung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, ein Deutsches Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit und ein Deutsches Zentrum für Psychische Gesundheit einzurichten (Bundesministerium, 2018), trägt deshalb auch der drängenden Notwendigkeit der Verbesserung der systematischen translationalen Erforschung der zugrundeliegenden pathophysiologischen Mechanismen psychischer Erkrankungen zur Verbesserung der Prävention, Diagnostik und Therapie Rechnung.
Welche Ziele sind in den beiden neuen Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung zu definieren?
Als prioritäre Zukunftsaufgaben der Forschung im Bereich Psychischer Gesundheit, die strategisch durch eine strukturelle und nachhaltige Förderung im Rahmen der neuen Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung verfolgt werden sollen, ergeben sich daher Aufgaben, welche in dem EU-geförderten Projekt „A Roadmap to Mental Health Research in Europe“ (ROAMER) (European Commission, 2015) als „six research priorities“ herausgearbeitet wurden, die in der folgenden Betrachtung aufgegriffen werden:
- 1Fokussierung auf Entwicklungsaspekte und kausale Mechanismen
- 2Nutzung internationaler Netzwerke und Datenbanken
- 3Translation von neuem Wissen und technologischen Verfahren in Therapie und Prävention
- 4Gesamtgesellschaftliche Reduktion von Stigmatisierung und Förderung von Partizipation der Betroffenen
- 5Steigerung der Bemühungen im Bereich Versorgungs- forschung
Prävention und Therapie im Entwicklungskontext
Nur mit einem profunden Verständnis der komplexen kausalen Mechanismen und ihrer Interaktion mit spezifischen belastenden Umweltfaktoren, die die Entstehung, Chronifizierung und Komorbiditätsentwicklung psychischer Erkrankungen bedingen und der Identifikation von Prädiktoren spezifischer Verlaufstrajektorien (ROAMER #2) kann es gelingen, wirksame präventive, diagnostische und therapeutische Konzepte in frühen Phasen der Entwicklung psychischer Erkrankungen zu erarbeiten (ROAMER #1).
Auf der Basis breiter methodischer und inhaltlicher Innovation der letzten Jahre gilt es nun, objektiv überprüfbare Modelle von Krankheitsentstehung und spezifischer trajektorieller Entwicklung zu generieren und zu validieren. Besonderer Fokus muss hierbei auf die frühe Gehirnentwicklung, auf kritische Transitionsphasen und der Wechselwirkung von biologischen und psychosozialen Risiken in verschiedenen Settings (Kindergarten, Schule, Familie) gelegt werden. Biologische Modellorganismen (z. B. Maus, Ratte, Zebrafisch, Zellmodell) können wesentliche funktionelle Einblicke ermöglichen und müssen durch die systematische Erforschung von Entwicklungsverläufen in longitudinalen humanen Kohorten ergänzt werden. Mittels multidimensionalen Phänotypisierungsstrategien (deep phenotyping) ist es erforderlich sowohl Patientenstichproben als auch populationsbasierte Kohorten longitudinal zu verfolgen. Dieser längsschnittliche Ansatz ist unentbehrlich, um einerseits frühe und entwicklungsspezifische Risiko- und Resilienzfaktoren zu identifizieren und pathophysiologische Zusammenhänge kausal zu klären, und um andererseits altersspezifische präventive und therapeutische Intervention zu entwickeln und ihre langfristigen Effekte bis ins Erwachsenenalter zu überprüfen.
Die traditionellen psychiatrischen Diagnosen sind für eine Personalisierung der Therapie nicht ausreichend. Von besonderer Bedeutung ist die Validierung psychosozialer und (neuro-) biologischer Prädiktoren zur Identifizie- rung von pathophysiologisch definierten Subtypen psychischer Erkrankungen, die innerhalb der ätiologisch heterogenen diagnostischen Kategorien durch übereinstimmende Krankheitsmechanismen gekennzeichnet sind. Diese ätiologische Subklassifizierung ermöglicht in der Folge die Verbesserung der Prognose individueller Krankheitsverläufe und der Therapieresponse. Die Ergebnisse longitudinaler Studien, die Identifikation kausaler Mechanismen, die Etablierung klinisch valider Biomarker im Zusammenwirken mit psychosozialen Risikofaktoren werden eine zunehmende Personalisierung (precision medicine) in der (psycho-)therapeutischen Versorgung von Patienten mit psychischen Erkrankungen ermöglichen (ROAMER #4). Hierzu gehört vor allem die Entwicklung und Evaluation altersadaptierter psychotherapeutischer Behandlungsmethoden, um spezifischere, effektivere und nebenwirkungsärmere Therapien für eine zunehmende Zahl von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen und ihren Familien zukünftig verfügbar zu machen.
Gleichermaßen muss den erhöhten Risiken, denen Kinder und Jugendlich durch den off-label Gebrauch von Psychopharmaka (und ebenso von somatischen Arzneimitteln) im Kindes- und Jugendalter ausgesetzt sind, durch die Etablierung industrieunabhängiger Plattformen für klinische Studien zur Wirksamkeit und (Langzeit-)Verträglichkeit von psychopharmakologischen (und psychotherapeutischen) Behandlungsoptionen für Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen begegnet werden. Damit verbunden ist der Ausbau der Pharmakovigilanzforschung im Kindes- und Jugendalter dringend geboten.
Forschung an der Schnittstelle von Soma und Psyche
Auch in Bezug auf Aspekte der Versorgungsforschung kann auf längsschnittliche Untersuchungen, beispielsweise bei der Überprüfung der Effekte von Kinderschutz-Maßnahmen und der altersspezifischen Implementation von Behandlungsleitlinien nicht verzichtet werden (ROAMER #6). Ebenso bestehen große Wissenslücken in der longitudinalen Wechselwirkung von Psyche und Soma. Körperliche Erkrankungen, wie z. B. Krebserkrankungen, Atopie oder chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, können psychische Belastungen bis hin zu sekundärer psychiatrischer Morbidität auslösen, gleichzeitig können psychische Erkrankungen körperliche Erkrankungen (z. B. Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes, Adipositas) bedingen oder das Risiko für körperliche Erkrankungen kann durch die medikamentöse Behandlung psychischer Erkrankungen noch erhöht werden, die rekursiven Mechanismen sind jedoch weitgehend unverstanden. Eine strukturelle Förderung, die longitudinale Studien mit akzelerierten Designs mittels multipler Kohorten ermöglicht und eine intelligente Einbindung bestehender Kohorten beinhaltet, kann damit aus entwicklungspsychiatrischer und somato-psychischer Perspektive erhebliche Synergieeffekte zwischen den beiden neuen Deutschen Gesundheitszentren schaffen.
Methodische Innovationen
Die Integration von Daten verschiedener Arbeitsgruppen, nationaler Konsortien und internationaler Verbünde in diese Zentren ist erforderlich, um eine erhebliche Effizienzsteigerung der Forschungsbemühungen zu bewirken. Die Vernetzung von Daten aus Konsortien, Datenbanken und Registern unter Anwendung innovativer Methoden setzt Expertise in Big Data-Technologien verbunden mit entsprechender statistischer Kompetenz der Vernetzung in gemeinsamen Plattformen und Datenbanken voraus (ROAMER #3). Die dadurch ermöglichte Integration umfassender mehrdimensionaler Daten und die Anwendung datengetriebener Klassifikationsansät- ze können zu transdiagnostischen pathophysiologischen Modellen führen, die die gegenwärtigen klinischen Klassifikationssysteme durch relevante neurobiologische und psychosoziale Biomarker ergänzen oder ggf. revidieren. Technologische Innovationen (z. B. App-based medicine, Telemedizin, Virtual Reality) sind aktuelle Ansätze, um klinische, experimentelle und real-life Daten zu verknüpfen und Forschungshypothesen einer ökologischen Überprüfung zugänglich zu machen sowie Möglichkeiten, individuell wirksame Interventionen in der Versorgung zu implementieren.
Partizipation und Teilhabe
Forschung an Kindern und Jugendlichen und an Patienten mit psychischen Erkrankungen ist aufgrund der hohen Vulnerabilität und des besonderen Schutzbedarfs an besondere ethische Bedingungen geknüpft und muss im Fall der Forschung an Minderjährigen stets auch die Eltern und Familien mit einbeziehen. Die alters- und krankheitsabhängige Einwilligungsfähigkeit bedarf einer fachgerechten Einschätzung im Einzelfall. Generell müssen ethische und rechtliche Fragen präventiver Interventionen im Kontext mit Forschungsansätzen, welche im Tierversuchsstadium schon Praxis sind (Interventionen beim noch Gesunden) im Rahmen der geplanten Zentren reflektiert werden.
Fragen in Bezug auf die Einschränkung von Grundrechten im Rahmen von freiheitsentziehenden Maßnahmen werden in der Öffentlichkeit und im Feld intensiv diskutiert und in den letzten Jahren und Jahrzehnten kam es zu einem breiten Umdenken, welches den Betroffenen und ihren Familien erheblich mehr Eigenbestimmung und Partizipation an Therapieprozessen zuspricht. Diese Aspekte sind im Kindes- und Jugendalter besonders sensibel und erfordern nicht nur einen kontinuierlichen ethischen Diskurs, sondern auch partizipative Ansätze der Versorgungsforschung, um Effekte von Maßnahmen einer patientenbezogenen und objektiveren Bewertung zuführen zu können. Der KJPPP kommt in diesem Kontext auch die Rolle eines Fürsprechers für die Belange der Kinder und Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen sowie ihrer Familien zu, und damit die Verpflichtung sich im gesellschaftlichen und politischen Leben und im rechtlichen Diskurs sowie der normativen Entwicklung für Teilhabe und Partizipation der Betroffenen einzusetzen (ROAMER #5).
Welche Rolle und Funktion kann die KJPPP in den beiden neuen Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung einnehmen?
Deutlich wird, dass die angekündigte strukturelle und nachhaltige Förderung der translationalen Forschung im Bereich Psyche und im Bereich Kindergesundheit in Form von zwei neuen Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung dringend erforderlich ist. Die KJPPP nimmt aufgrund der hohen Relevanz entwicklungspsychiatrischer Forschungsthemen in beiden neuen Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung eine zentrale Rolle ein. Zudem sollte die KJPPP eine Brückenfunktion einnehmen und wünschenswerte Synergien zwischen den beiden Deutschen Zentren herstellen (vgl. Abbildung 3).
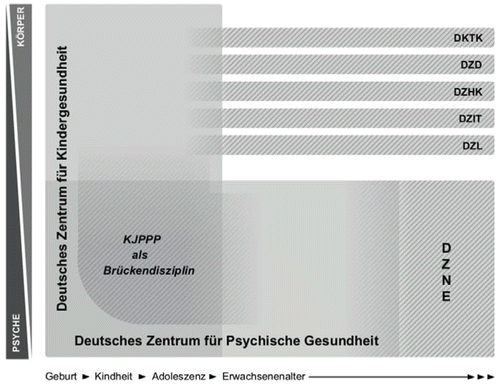
Aus den beschriebenen Zukunftsaufgaben der Erforschung psychischer Morbidität im entwicklungspsychiatrischen Längsschnitt ebenso wie aus der komplexen Interaktion zwischen Körper und Psyche ergeben sich wesentliche strukturelle Merkmale, die in den zukünftigen beiden Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung abgebildet werden müssen.
- 1Beide neuen Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung sind zwingend in Netzwerkstrukturen in Verbünden aus universitären und außeruniversitären Standorten zu etablieren. Hierfür ist insbesondere im Kindes – und Jugendalter eine ausreichende Anzahl von leistungsstarken Zentren zu inkludieren, da relevante Stichproben nur in Verbünden realisierbar sind.
- 2Die Netzwerkstrukturen sollten aus Standorten bestehen, die einerseits bereits durch eine enge interdisziplinäre Kooperation von leistungsstarken Partnern der KJPPP und Psychiatrie oder Kinderheilkunde bestehen. Andererseits müssen auch Standorte Berücksichtigung finden, deren spezifische kinder- und jugendpsychiatrische Expertise essentiell für die Konzeption der beiden neuen Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung sein wird.
- 3Um Synergien für die beiden Zentren vermittelt durch die KJPPP zu nutzen und zu optimieren sind „interaktive Knotenpunkte“ zwischen den beiden neuen Gesundheitszentren vorzusehen, so dass diese geschilderte, dringend notwendige Vernetzung auch struk- turell gegeben ist.
In der translationalen Dissemination und Implementation von entwicklungsspezifischen, evidenzbasierten Interventionen und Präventionsmaßnahmen wird die KJPPP durch enge kooperative Vernetzung mit Schule, Pädagogik, Jugendhilfe und Psychologie wissenschaftliche Erkennt- nisse wirksam in die breite Anwendung übertragen und dadurch die gesamtgesellschaftliche Belastung durch psychische Erkrankungen über die gesamte Lebensspanne wirksam reduzieren.
V. Roessner hat Vortragshonorare von Lilly, Novartis, Shire Pharmaceuticals und Medice Pharma, sowie Forschungsunterstützung von Shire Pharmaceuticals und Novartis erhalten und war in fachberatender Funktion für Lilly, Novartis, und Shire Pharmaceuticals.
T. Banaschewski war innerhalb der letzten drei Jahre als Berater für die Firmen Eli Lilly, Lundbeck, Medice, Neurim Pharmaceuticals, Novartis und Shire tätig und hat Vortragshonorare von den Firmen Lilly, Medice, Novartis und Shire sowie Drittmittelförderung von den Firmen Shire und Viforpharma erhalten. Die vorliegende Publikation steht damit nicht im Zusammenhang. Die anderen Autoren erklären keine Interessenskonflikte.
Literatur
(2018) Der Verlauf psychischer Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen – Ergebnisse der KiGGS-Kohorte. Journal of Health Monitoring, 3, doi:10.17886/RKI-GBE-2018-011, Robert Koch-Institut, Berlin.
(2015) The ‘Early Developmental Stages of Psychopathology (EDSP) study’: A 20 year review of methods and findings. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 50, 851–866.
(2007) Prevalence and psychological correlates of occasional and repetitive deliberate self-harm in adolescents. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 161, 641–9.
Bundesministerium für Bildung und Forschung (2018) vom 06.09.2018 (Pressemitteilung) https://www.bmbf.de/de/startschuss fuer-zwei-neue-deutsche-zentren-der-gesundheitsforschung- 6872.html (abgerufen 31.12.2018).Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung . (2018) Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. https://www.bmz.de/de/ministerium/ziele/2030_agenda/index.html (abgerufen 31.12.2018).(2000) Duration between onset and time of obtaining initial treatment among people with anxiety and mood disorders: an international survey of members of mental health patient advocate groups. Psychological medicine, 30, 693–703.
(2018) Association of child maltreatment subtypes and long-term physical health in a German representative sample. European Journal of Psychotraumatology, 9, 1510278.
(2013) Chief Medical Officer’s annual report 2012: our children deserve better: prevention pays. London: Department of Health. https://www.gov.uk/government/publications/chief-medical-officers-annual-report-2012-our-children-deserve-better-prevention-pays (abgerufen 31.12.2018).
European Commission (2013a) Brain Research supported by the European Union 2007–2012. A unique commitment 1,268 projects. Brussels. http://ec.europa.eu/research/conferences/2013/brain-month/pdf/publication_emob.pdf (abgerufen 31.12.2018).European Commission (2013) Sixth FP7 monitoring report (monitoring report 2012). Brussels. http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_ reports/6th_fp7_monitoring_report.pdf (abgerufen 31.12.2018).European Commission (2015) ROAMER – A roadmap for Mental Health Research in Europe. Final report summary. https://cordis.europa.eu/result/rcn/171328_de.html (abgerufen 31.12.2018).(2016) Übergang zwischen Jugend- und Erwachsenenalter: Herausforderungen für die Transitionspsychiatrie. Eckpunktepapier von DGKJP und DGPPN. http://www.dgkjp.de/stellungnahmen-positionspapiere/stellungnahmen-2016/396-uebergang-zwischen-jugend-und-erwachsenenalter-herausforderungen-fuer-die-transitionspsychiatrie (abgerufen 31.12.2018).
(2011) Cost of disorders of the brain in Europe 2010. European Neuropsychopharmacology, 21, 718–779
(2014) ROAMER: roadmap for mental health research in Europe. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 23 Suppl 1, 1–14.
(2007) Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 50, 784–793.
(2014) Psychische Auffälligkeiten und psychosoziale Beeinträchtigungen bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren in Deutschland – Prävalenz und zeitliche Trends zu 2 Erhebungszeitpunkten (2003–2006 und 2009–2012) Ergebnisse der KiGGS-Studie – Erste Folgebefragung (KiGGS Welle 1). Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, 57, 807–819
(2011a) Explaining gender differences in non-fatal suicidal behaviour among adolescents: a population-based study. BMC Public Health, 11, 597.
(2011b) Childhood Experiences of Care and Abuse (CECA) Validierung der deutschen Version von Fragebogen und korrespondierendem Interview sowie Ergebnisse einer Untersuchung von Zusammenhängen belastender Kindheitserlebnisse mit suizidalen Verhaltensweisen. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 39, 243–252.
(2016) National Trends in the Prevalence and Treatment of Depression in Adolescents and Young Adults. Pediatrics, 138, e20161878
National Institute of Mental Health , (2018) https://www.nimh.nih.gov/research-priorities/rdoc/index.shtml (abgerufen 31.12.2018).(2005) Introduction: Adressing the Millenial Morbidity – The Context of Community Pediatrics. Pediatrics 115: 1121–1123.
(2008) Die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Daten aus dem bundesweit repräsentativen Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS). Umweltmedizin in Forschung und Praxis, 13, 245–260
(2007) Delay and failure in treatment seeking after first onset of mental disorders in the World Health Organization’s World Mental Health Survey Initiative. World Psychiatry, 6, 177–85.
(2015) The Global Burden of Mental, Neurological and Substance Use Disorders: An Analysis from the Global Burden of Disease Study 2010. Plos One, 10, e0116820.
(2011) The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. European Journal of Neuropsychopharmacology, 21, 655–79.
(2014) Somatic and mental health service use of children and adolescents in Germany (KiGGS-study), European Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 23: 753–764.
World Health Organization (2004) The global burden of disea- se: 2004 update. http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_full.pdf (abgerufen 31.12.2018).



