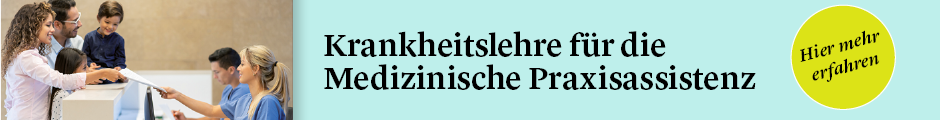Häusliche Gewalt am Universitären Notfallzentrum Bern: eine retrospektive Analyse von 2006 bis 2016
Abstract
Zusammenfassung. Häusliche Gewalt (HG) wird weltweit als eines der grössten Gesundheitsrisiken eingeschätzt. Seit 2004 ist HG in der Schweiz ein Offizialdelikt. Die vorliegende retrospektive Kohortenstudie aus dem universitären Notfallzentrum untersucht Fälle von HG. Die meisten Fälle ereignen sich sonntags und spätabends. Die Angreifer sind grösstenteils Männer und (Ex-)Ehemänner oder (Ex-)Partner. Kopf und Extremitäten sind hauptsächlich betroffen. Würgen am Hals wurde bei 16 % der Patienten dokumentiert. Die Prävalenz ist mit 0,07 % im Jahr 2016 sehr niedrig (Overall 2006–2016 0,09 %) und niedriger als internationale Daten. Wir vermuten, dass eine grosse Dunkelziffer existiert und die Opfer vermeiden, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Medizinisches Personal muss regelmässig geschult werden, standardisierte Vorgehensweisen müssen definiert sowie ein sensibler, offener Umgang gepflegt werden.
Abstract. Domestic Violence (DV) is considered as one of the largest medical risks worldwide. In Switzerland, DV is defined as offence requiring public prosecution since 2004. The present retrospective cohort study aims to investigate cases of DV in one of the largest Swiss emergency departments. The aggressors are predominantly male and either (ex-)partner or (ex-)husband of the victim. The head and the extremities are most often injured. Strangulation was documented in 16 % of the cases. Prevalence in our ED is very low with 0.07 % in 2016 (overall 0.09 % 2006–2016) and much lower compared with international data. We assume that we face many unreported cases and that victims are reluctant to seek medical help. Healthcare professionals should receive regular education in domestic violence, standards of care must be defined, and a sensitive and open-minded communication style is essential.
Résumé. La violence domestique est considérée à travers le monde comme l’un des plus grands risques de problèmes de santé. Depuis 2004 elle fait partie des délits officiels en Suisse. La présente étude rétrospective de cohorte du service universitaire des urgences de Berne analyse les cas de violence domestique. La majorité des cas se présentent le dimanche et en soirée. Les agresseurs sont en grande partie des hommes et des (ex-)maris ou (ex-)partenaires. La tête et les extrémités sont principalement touchées. La prévalence reste basse avec une valeur de 0,07 % de manière constante (global de 2006–2016 à 0,09 %) et inférieure aux données internationales. Nous estimons que les chiffres réels sont plus élevés et que les victimes évitent d’avoir recours à des soins médicaux. Le personnel médical doit être régulièrement formé, des procédures standardisées doivent être définies ainsi qu’une relation plus sensible et plus ouverte doit être mise en place.
Hintergrund und Fragestellung
Gewalt gegen Frauen und Männer wird von internationalen Organisationen als eines der grössten Gesundheitsrisiken eingeschätzt [1]. Studien zeigen, dass insbesondere Opfer systematischer und fortgesetzter Gewalt schwerwiegende gesundheitliche Beeinträchtigungen und soziale Auswirkungen erleiden [2]. Seit 2004 gelten, mit Ausnahme der einmaligen Tätlichkeit, neu zusätzlich die einfache Körperverletzung, schwere Drohung sowie wiederholte Tätlichkeiten in Paarbeziehungen (Eheleute, eingetragene Partnerschaften und Partner mit gemeinsamem Haushalt) in der Schweiz als Offizialdelikte. Unter HG wird die Anwendung oder Androhung von Gewalt unter Paaren in bestehender oder aufgelöster ehelicher oder partnerschaftlicher Beziehung, zwischen Eltern (auch Stief-/Pflegeeltern) und Kind oder zwischen weiteren Verwandten verstanden [3]. Im Laufe der Jahre entstanden mehrere Studien über die sozioökonomischen Faktoren von HG mit dem Ziel, Kenntnisse zu deren Prävention zu erlangen. Medizinische Studien zum Thema HG in der Schweiz sind rar. 2003 wurde erstmals vom Bundesamt für Gesundheit ein Fragebogen zum Thema «häusliche Gewalt unter Partnern» an die Hausärzte abgegeben [4]. 2004 veröffentlichte die Maternité Inselhof des Triemlispitals in Zürich eine Patientinnenbefragung [5]. 15,7 % der Frauen gaben an, in der aktuellen Beziehung Gewalt ausgesetzt zu sein [5]. 2006 eröffnete das Universitätsspital Lausanne eine Abteilung für forensische Medizin und publizierte 2009 Daten aus dem Projekt. Ein Jahr nach deren Inbetriebnahme waren ein Drittel der Opfer HG ausgesetzt [6]. Bereits im Jahr 2010 veröffentlichte das Inselspital Bern eine semi-quantitative Studie über die forensische Dokumentation von HG [7]. Hierbei zeigte sich eine Prävalenz von 0,4 %. Im weiteren Verlauf erschienen verschiedene nationale Handlungsanleitungen für Ärzte sowie Studien, die sich mit speziellen Personengruppen befassten (ältere Personen, Kinder, Schwangere, sexuelle Übergriffe). Ziel dieser Studie ist es nun, umfassend Daten von Opfern von HG zu erfassen, die sich auf dem UNZ vorstellen, und eine deskriptive Datenanalyse zu erarbeiten. Diese Arbeit soll den Opfern helfen, durch ein strukturiertes, standardisiertes Vorgehen und eine gute Schulung aber auch Ärzten und Pflegenden [8, 9, 10].
Methodik und Analyse
Die vorliegende Kohortenstudie ist eine deskriptive, retrospektive Datenanalyse von Patienten, die als Opfer von HG zwischen 2006 und 2016 im UNZ vorstellig wurden.
Eingeschlossen wurden volljährige Patienten des UNZ mit einem Vermerk von HG (gemäss Definition der PKS) in den zwei Krankenhausinformationssystemen Qualicare (Qualidoc AG, Trimbach, Schweiz) für die Daten im Zeitraum 01.01.2006 bis 30.04.2012 und E-care (E.care bvba, Turnhout, Belgien) für den Zeitraum vom 01.05.2012 bis zum 31.12.2016. Dementsprechend wurden die Opfer selektioniert und in die Studie eingeschlossen. Patienten, die von extern an eine Fremdklinik via UNZ zur operativen Versorgung zugewiesen wurden, wurden ausgeschlossen, da die Dokumentation ungenügend war. Opfer, die mehrmals am UNZ vorstellig wurden aufgrund HG, wurden einzeln registriert und als Rezidiv vermerkt. Bei allen erfassten Patienten wurden die medizinischen Berichte analysiert. Es wurden demografische, klinische, zeitliche und Tat-bezogene Daten erfasst sowie Informationen über Täter, Zuweiser und Zuzug von Spezialisten.
Strafrechtliche sowie bevölkerungsstatistische Daten wurden uns vom Bundesamt für Statistik aus PKS (2009–2016), ESPOP (bis 2010) und STATPOP (ab 2011) in Form von Tabellen zur Verfügung gestellt. Die Datenanalyse wurde mittels Microsoft Excel durchgeführt. Die Studie wurde von der Ethikkommission Bern genehmigt.
Resultate
Im Zeitraum 2006 bis 2016 wurden 379 900 Patienten am UNZ behandelt. 455 wurden in den Krankenhausinformationssystemen unter dem Stichwort «HG» erfasst. 118 Patienten mussten ausgeschlossen werden (Tab. 1). Es verblieben 337 Patienten, die eingeschlossen werden konnten. Es zeigte sich ein Mittel von 30,6 Fällen häuslicher Gewalt/Jahr. Für das Jahr 2016 ergab dies eine Prävalenz von 0,07 %. Die Anzahl Fälle von HG im UNZ während der Studienzeit blieb praktisch konstant trotz Zunahme der Totalpatientenzahl um 60,5 % und der Wohnbevölkerung des Kantons Bern um 7 %.

Opfer
94 % der Opfer waren Frauen, davon rund die Hälfte mit Schweizer Staatsbürgerschaft, in 50 % der Fälle waren Kinder mit betroffen, in 32 % wurden dazu keine Angaben in den Unterlagen gefunden. Ob ein Migrationshintergrund bestand, konnte anhand der Daten nicht eruiert werden (Tab. 2).

Die bekannten Risikofaktoren (Alkohol, Drogen, Trennungssituationen, psychische Vorbelastung) spielten auch bei uns eine Rolle (Abb. 1).

Zeitpunkt der Erstvorstellung
81 Konsultationen fanden in der Frühschicht (7:15–14:30), 143 in der Spätschicht (14:30–22:30) und 110 in der Nachtschicht (22:30–7:15) statt. Bei drei Patienten fehlten die Zeitangaben. Die Wochenverteilung der Konsultationen zeigte ein Maximum am Sonntag mit 62 Patienten. 48 % der Konsultationen erfolgten am Wochenende (Freitag bis Sonntag) (Abb. 2).

Es zeigte sich ein Maximum von 66 Fällen von HG im Jahr 2014 und ein Minimum von zwölf Fällen im Jahr 2013. Nach 2014 stabilisierte sich der Wert bei 34 Fällen pro Jahr (Abb. 3).

57 % der Befragten gaben an, bereits einmal in der aktuellen Beziehung Opfer von HG geworden zu sein. Lediglich 7 % der Opfer stellten sich mehrfach auf dem UNZ aufgrund von HG vor, im Durchschnitt kam es zu drei Konsultationen/Patient. Der höchste Wert lag bei 9 Konsultationen. Hierbei wurden auch Vorstellungen aufgrund polizeilicher Vorführung nach HG bei psychischer Dekompensation eingeschlossen. Ob es zu einer Verschlimmerung der Verletzungen und einer Zunahme der Frequenz der Konsultationen kam, kann aufgrund der geringen Fallzahl nicht gesagt werden. Zudem muss der Tatmechanismus nicht zwingend mit der Schwere des Verletzungsmusters korrelieren.
Zuweiser
In 50 % der Fälle stellten sich die Patienten selbstständig nach HG auf dem Notfall vor, in 24 % wurden sie durch die Polizei vorgeführt (Abb. 4).

Tat/Täter
Täter waren in 50 % der Ehepartner oder Ex-Ehepartner, in 37 % der Lebenspartner oder Ex-Lebenspartner. Eltern sowie andere Familienangehörige (Tanten, Onkel) wurden in je 3 % als Täter genannt, Kinder in 4 %.
Tathergang
Als häufigster Tathergang wurde von den Opfern Schlagen und Treten angegeben (Abb. 5).

Als Tatmittel wurde am häufigsten die offene Hand oder die Faust benutzt (Abb. 6).

Verletzungsort/Verletzungsmuster
Die am häufigsten verletzte Körperregion war der Kopf, gefolgt von den Armen (Abb. 7). Die am häufigsten dokumentierte Verletzungsart waren Hämatome und Prellungen (Abb. 8). 55-mal wurden die Opfer gewürgt. Bei allen 55 Patienten war der primäre neurologische Status unauffällig. Trotzdem wurde in 42 % eine Bildgebung der Halsgefässe gemacht (CT Angio 33 %/MRI Angio 9 %), die ebenfalls bezüglich Verletzungen der Halsgefässe negativ war. Ein MRI zeigte Auffälligkeiten im forensischen Sinn mit Einblutungen muskulär submandibulär. Patienten nach überlebter Strangulation wurden bis dato nicht häufiger vorstellig, ein Opfer meldete sich drei Jahre nach Würgeereignis mit Nackenschmerzen und sechs Jahre nach Ereignis mit einer Sinusvenenthrombose unklarer Ätiologie.


In den elf Jahren der Datenerfassung kam es zu keiner Vorstellung nach häuslicher Gewalt mit Anwendung einer Schusswaffe.
Zuzug von Spezialisten
186-mal wurden Spezialisten kontaktiert, dabei nur 49-mal das Institut für Rechtsmedizin IRM und 20-mal direkt die Opferhilfe. Aus den Patientenakten geht oft nicht hervor, ob ein Kontakt während des Aufenthalts stattfand (Abb. 9).

Weiterbetreuung
205 Patienten konnten ambulant betreut werden, 37 mussten hospitalisiert werden, von 95 fehlten eindeutige Angaben. 16 Patienten wurden psychiatrisch hospitalisiert, wobei elf bereits eine relevante psychiatrische Diagnose hatten (Alkoholabhängigkeit, Schizophrenie, schwere posttraumatische Belastungsstörung etc.), sechs Patienten auf der Intensivstation. Die Hospitalisationen auf der Intensivstation erfolgten zweimalig zur Extubation, zweimalig zur Kreislaufüberwachung bei grösserer Blutung sowie zweimalig bei psychiatrischer Indikation nach häuslicher Gewalt. Bei keinem Opfer bestand zum Zeitpunkt der Hospitalisation Lebensgefahr.
Insgesamt mussten neun Opfer während der Hospitalisation operiert werden. Sechs Eingriffe fanden durch die Kollegen der Plastischen-/Handchirurgie statt, die weiteren Operationen durch die Schädel-Kieferchirurgen und die Orthopäden. Operationen, die ambulant oder nach Wiedereintritt (z.B. Orbitafrakturen, Nasenbeinfrakturen, Unterarmfrakturen etc.) gemacht wurden, wurden nicht erfasst.
Diskussion
Häusliche Gewalt findet dann statt, wenn die Partner zu Hause sind. Dies zeigt sich in der zeitlichen Verteilung der Konsultationen. Fast die Hälfte der Konsultationen fand am Wochenende statt, meistens nachmittags oder nachts. Diese Zahlen decken sich mit den Zahlen aus der PKS sowie anderer Studien [5, 6]. Bezüglich der soziodemografischen Faktoren ergaben sich keine neuen Erkenntnisse, es zeigte sich lediglich ein etwas erhöhter Anteil weiblicher Opfer [3, 4, 6, 11, 12]. In der Sentinella-Studie wurden die Patienten aktiv nach dem Vorliegen von HG gefragt, was zu einer höheren Vertretung von Männern als Opfer führte. Dies war in dieser retrospektiven Studie nicht möglich, sodass möglicherweise männliche Opfer im UNZ unter falschen Angaben eines Verletzungsmechanismus als Opfer von HG verkannt wurden. Die bekannten Risikofaktoren (Alkohol, Drogen, Trennungssituationen, psychische Vorbelastung) [3, 5, 13, 14] bestätigten sich auch in unserer Studie (Abb. 1). Bekannte psychische Erkrankungen sowie Alkohol und Drogenkonsum spielten hierbei die wichtigsten Rollen. Alkohol und Drogen wurden nicht nur im Rahmen einer chronischen Abhängigkeit als Risikofaktor betrachtet und eingeschlossen, sondern auch als einmaliger Konsum vor der Tat. Erstmalig in der Schweiz untersuchten wir Tathergang und Verletzungsmuster. Daraus geht hervor, dass es in den meisten Fällen durch Schläge mit der offenen Hand oder der Faust primär im Bereich des Kopfes zu Prellungen und Hämatomen, Platzwunden und Blutungen kam. Die Verletzungen an den Armen lassen sich einerseits durch Festhalten, aber auch durch Abwehrmechanismen erklären. Beängstigend hoch ist die Zahl der Strangulationen mit 55 Fällen (16 %). Einerseits konnte Glass [15] zeigen, dass sogenannte «nicht-tödliche Strangulationen» ein wichtiger Risikofaktor für Tötungsdelikte sind, andererseits ist bekannt, dass Gefässverletzungen zwar selten sind, aber aufgrund der initial oft asymptomatischen Klinik häufig verpasst werden und nach Tagen bis Wochen schwerwiegende Konsequenzen haben können (von Gedächtnisstörungen bis zum Stroke und tödlichen Verläufen) [16]. Bis dato sind aus dem Kollektiv der «überlebten Strangulationen» der UNZ-Studie bis auf das Opfer mit der Sinusvenenthrombose keine weiteren vermehrten Vorstellungen im Inselspital aufgrund von unklaren neurologischen Symptomen bekannt. Die zu 100 % negative Bildgebung im UNZ scheint das zu bestätigen, was die Literatur sagt: keine Bildgebung bei neurologisch unauffälligen Patienten ohne Schmerzen über der Carotis. Viel wichtiger ist die Aufklärung der Ärzte und Patienten, dass Spätfolgen nach Würgetrauma noch nach Wochen bis Jahren auftreten können und einer umgehenden Untersuchung bedürfen [17, 18].
Die Overall-Prävalenz von 0,09 % erscheint im internationalen Vergleich eher niedrig [11, 19]. Aus einer schweizweiten Befragung, durchgeführt bei Hausärzten, ergab sich im Jahr 2003 sogar eine Inzidenz von 0,025 % [4]. Die aktuellste Befragung im Kanton Bern im Jahr 2017 ergab, dass die Mehrheit der befragten Ärzte lediglich ein bis drei Fälle von HG/Jahr betreuen. 1997 wurde durch die UNO eine Vergleichsstudie [13] zur Gewalt an Frauen initiiert, an der im Jahr 2003 die Schweiz teilnahm. Dabei zeigte sich eine Lifetime-Prävalenz der HG von 10,5 % [20]. Die Schweiz lag somit deutlich unter der von der WHO angegebenen Lifetime-Prävalenz für Europa von 25,4 % [1]. Gemäss der europäischen Union gaben 22 % der befragten Frauen an, körperliche und/oder sexuelle Gewalt in einer Partnerschaft erlebt zu haben [21]. Die deutlich niedrigere Lifetime-Prävalenz im Vergleich zu Europa kann ein Grund für die niedrigen Zahlen unserer Studie sein.
In der seit 2009 in revidierter Form vorliegenden PKS werden Umfang, Struktur und Entwicklung der registrierten Straftaten in einem vordefinierten Tatbestandskreis schweizweit einheitlich erfasst und nach verschiedenen Kriterien verglichen. Für den Kanton Bern zeigt sich seit 2009 ein leichter Rückgang der Straftatbestände um die HG von 1432 auf 1335 Straftatbestände/Jahr [3]. Dies bedeutet eine Abnahme von 6,8 %, während es zu einer Zunahme der ständigen Wohnbevölkerung des Kantons Bern um 5,3 % kam [22]. In den Jahren ab 1997 wurde schweizweit viel in die Prävention der HG investiert und Gesetze wurden angepasst. So kam es im Jahr 2007 unter anderem zur Revision des Opferhilfegesetzes und Anpassungen im Zivilgesetzbuch. Ob das Absinken der Fallzahlen der Studie in den Jahren 2010 bis 2013 lediglich verzögerte Auswirkungen solcher Massnahmen sind, kann nicht gesagt werden. Die Tatsache, dass die Fallzahlen der UNZ-Studie nach 2013 erneut ansteigen, die Bemühungen in der Prävention der HG nach 2013 weitergeführt und ausgebaut wurden, sowie die Zahlen der HG gemäss PKS seit dem Jahr 2010 tendenziell rückläufig sind, in der UNZ-Studie aber auf konstantem Niveau verblieben, deuten darauf hin, dass kein direkter Zusammenhang mit Präventionsmassnahmen gefunden werden kann.
Während in der PKS von der Anzahl Straftatbestände gesprochen wird, listet die Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern POM in der Jahresstatistik 2016 715 Interventionen/Jahr aufgrund HG im gesamten Kanton Bern auf [3]. Gemäss der schweizerischen Opferhilfebefragung 2011 muss davon ausgegangen werden, dass die Polizei von circa 20 % der Fälle HG Kenntnis hat. 54 % der polizeilichen Interventionen entfielen auf das Haupteinzugsgebiet des Inselspitals Bern (Bern/Mittelland). Bei 27 % der Interventionen wurden medizinische Massnahmen notwendig, wobei nicht genauer angegeben wurde, in welcher Form diese stattfanden (Hausarzt/Stadtspital/Unispital/Psychiatrie). Von diesen Zahlen ausgehend, sind somit circa 100 Menschen/Jahr im Raum Berner Mittelland von HG betroffen und benötigen medizinische Betreuung. In unserer Studie wurden jährlich im Schnitt nur acht Fälle von der Polizei zugewiesen. Diese Diskrepanz kann auf mehreren Faktoren beruhen: Im Raum Berner Mittelland befinden sich mehrere Notaufnahmen, in die Opfer von HG zur Erstversorgung zugewiesen werden können. Zudem fehlen in der Statistik der POM Angaben, in wie vielen Fällen es sich bei den Interventionen um sexuelle Gewalt im häuslichen Bereich gehandelt hat. Bei Opfern sexueller Gewalt findet die Erstversorgung oft direkt in der Frauenklinik statt. Aus der Frauenklinik wurden während der Studienzeit nur 10 Fälle zur weiteren Betreuung zugewiesen, was uns sehr wenig erscheint. Aufgrund verschiedener Publikationen müssen wir davon ausgehen, dass mehr Opfer nach sexuellen Übergriffen schwere, abklärungsbedürftige Verletzungen aufweisen [23, 24]. Gemäss Angaben der Frauenklinik werden jährlich circa 10 Opfer sexueller Übergriffe im Rahmen häuslicher Gewalt behandelt. Dies ergibt eine korrigierte Prävalenz von 0,1 %.
Zusammenfassung
Mit einer Prävalenz von 0,07 % im Jahr 2016 (korrigierte Prävalenz inklusive Sexualdelikte 0,1 %, Prävalenz im UNZ 2006–2016 0,09 %) ist HG in unserer Studie im internationalen Vergleich niedrig. Im nationalen Vergleich zeigt sich aber, dass medizinische Hilfe von Opfern von HG wenig in Anspruch genommen wird. Umso wichtiger ist es, dass die oft diffusen Zeichen HG richtig erkannt werden. Ein standardisiertes Vorgehen zur Anamneseerhebung wie auch zur Befunddokumentation, zusammen mit kontinuierlich geschultem Personal ist unumgänglich. Nur dies führt zu einer guten Primär- und Nachbetreuung der Opfer und Familien. Zusätzlich nötig sind weitere Studien und intensivere Zusammenarbeit mit der Frauenklinik, dem Kinderspital sowie mit den Opferhilfestellen, die in der Betreuung von Opfern HG beteiligt sind, um das gesamte Ausmass der HG erfassen zu können.
Limitationen
Die Studie weist verschiedene Limitationen auf. Stark limitierend war die Tatsache, dass es weder standardisierte Fragen- noch Untersuchungsprotokolle zu HG gab und die Befrager über die 11 Jahre sehr inhomogen waren. Der Vergleich mit internationalen Studien zeigte sich erschwert, da es sich oft um Studien mit unterschiedlichen Einschlusskriterien (gescreente Studien) handelte, was die Fallzahl deutlich erhöht; zudem erschweren länderspezifische Unterschiede in der Definition von HG einen Vergleich zusätzlich.
Auch der Vergleich mit den Zahlen der PKS ist differenziert zu betrachten. Die Datenerfassung der PKS unterliegt im Vorfeld ebenfalls gewissen Selektionsprozessen (unterschiedliches Meldeverhalten der Melder an die Polizei, ob Melder männlich oder weiblich, Alter, Einstellung gegenüber Gewalt in Partnerschaft etc.). Zudem wird in der PKS die Zahl der Straftatbestände bei HG aufgelistet, die nicht gleichzusetzen ist mit der Anzahl der polizeilichen Interventionen, die mit der Zahl der Fälle von HG am UNZ eher zu vergleichen wäre. Zusätzlich sind in der PKS Straftatbestände erfasst, die selten zur Vorstellung am UNZ führen werden (Drohung, Missbrauch der Fernmeldeanlagen, Freiheitsberaubung).
Eine zusätzliche Limitation dieser Studie war die Tatsache, dass die Opfer sexueller Gewalt ohne weitere signifikante Körperverletzungen direkt in der Frauenklinik betreut und nicht an das UNZ weitergewiesen werden. Somit wurden praktisch alle Opfer sexueller Gewalt im häuslichen Umfeld nicht in diese Studie aufgenommen.
Das Jahr 2014 zeigt einen ungewöhnlich hohen Wert von 66 Fällen/Jahr. Dieser Wert spiegelt sich in keiner Erfassung der häuslichen Gewalt wider (kantonal/Schweiz), auch zeigt sich keine erhöhte Gesamtpatientenzahl im UNZ im Jahr 2014, sodass dieser Wert für uns nicht zu erklären ist.
Key messages
- •Die absolute Zahl der Fälle häuslicher Gewalt in der Notaufnahme stieg nur minim an, während die Zahl der Straftaten bei häuslicher Gewalt in der Schweiz um 9,2 % zunahm.
- •Die Prävalenz von Opfer häuslicher Gewalt liegt mit 0,07 % im Jahr 2016 (korrigierte Prävalenz inklusive Sexualdelikte 0,01 %, Prävalenz im UNZ 2006–2016 0,09 %) sehr niedrig.
- •In der Hälfte der Fälle leben Kinder in der Familie, in der Gewalt ausgeübt wird.
- •Strangulationen im Rahmen HG sind ein Zeichen für ein erhöhtes Gewaltpotenzial und können erst nach Tagen bis Wochen symptomatisch werden.
- •Es scheint eine hohe Hemmschwelle zu bestehen, medizinische Hilfe anzufordern. Entsprechend muss das Thema in medizinischen Kreisen durch Fortbildungen präsent bleiben.
Im Artikel verwendete Abkürzungen:
UNZ Universitäres Notfallzentrum
HG Häusliche Gewalt
PKS Polizeiliche Kriminalstatistik
POM Polizei- und Militärdirektion Kanton Bern
ESPOP Statistik der Bevölkerung und Haushalte ab 1981–2010
STATPOP Statistik der Bevölkerung und Haushalte ab 2011
Bibliografie
: Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence: World Health Organization: 2013.
: Beurteilung des Scheregrades häuslicher Gewalt – Sozialwissenschaftlicher Grundlagenbericht. EBG; Bern: 2012.
Bundesamt für Statistik : Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) Jahresbericht 2016. Neuchâtel: 2017.: Ärztinnen und Ärzte sind unverzichtbare Partner in der Bekämpfung von häuslicher Gewalt. Auswertung und Analyse von Sentinella-Daten. Schweiz Ärzteztg 2008; 89: 4.
Fachstelle für Gleichstellung; Frauenklinik Maternité STVIT, Zürich . Häusliche Gewalt erkennen und richtig reagieren. 2. Auflage. Bern: 2010.: Characteristics of victims of violence admitted to a specialized medico-legal unit in Switzerland. J Forensic Leg Med 2009; 16: 269–272.
: ’On the way to light the dark’: a retrospective inquiry into the registered cases of domestic violence towards women over a six year period with a semi-quantitative analysis of the corresponding forensic documentation. Swiss Med Wkly 2010; 140: w13047.
: Emergency department-based interventions for women suffering domestic abuse: a critical literature review. Eur J Emerg Med 2017; 24: 13–18.
, : An evaluation of a system-change training model to improve emergency department response to battered women. Acad Emerg Med 2001; 8: 131–138.
: Impact of an education program about domestic violence on nurses and doctors in an Australian emergency department. J Emerg Nurs 1997; 23: 220–227.
, : Prevalence of domestic violence among trauma patients. JAMA Surg 2015; 150: 1177–1183.
Generalsekretariat der Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern (Hrsg) : Häusliche Gewalt im Kanton Bern, Jahresstatistik 2016. 2017.: Violence against women: a statistical overview, and challenges and gaps in data collection and methodology and approaches for overcoming them. Division for the Advancement of Women: 2005.
Organization WH : Intimate partner violence: Understanding and addressing violence against women. World Health Organization and Pan American Health Organization: 2012., : Non-fatal strangulation is an important risk factor for homicide of women. J Emerg Med 2008; 35: 329–335.
: Injuries of women surviving intimate partner strangulation and subsequent emergency health care seeking: an integrative evidence review. J Emerg Nurs 2017; pii: S0099–1767 (17)30432–4. doi: 10.1016/j.jen.2017.12.001. [Epub ahead of print]
, : Patient presentation, angiographic features, and treatment of strangulation-induced dissection of the internal carotid artery: Report of three cases. J Neurosurg 2000; 92: 481–487.
: Evaluation and management for carotid dissection in patients presenting after choking or strangulation. J Emerg Med 2011; 40: 355–358.
: Domestic violence against women: incidence and prevalence in an emergency department population. Jama 1995; 273: 1763–1767.
: Gewalt gegen Frauen in der Schweiz–Resultate einer internationalen Befragung. Crimiscope 2004; 25: 1–5.
Union AdE : Gewalt gegen Frauen: Eine EU-weite Erhebung. Ergebnisse auf einen Blick. 2014. http://fra.europa.eu/de/publication/2014/gewalt-gegen-frauen-eine-eu-weite-erhebung-ergebnisse-auf-einen-blick; letzter Zugriff: 29.05.2018.Bundesamt für Statistik . http://www.bfs.admin.ch/ bfsstatic/dam/assets/3222015/master: Sexual assault and general body injuries: A detailed cross-sectional Australian study of 1163 women. Forensic Sci Int 2017; 279: 112–120.
: A comparison of intimate partner and other sexual assault survivors’ use of different types of specialized hospital-based violence services. BMC Womens Health 2017; 17: 59.