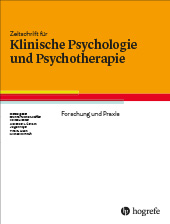Krankheitsängste bei Psychotherapeut_innen
Eine explorative Studie zu Ängsten vor psychischen Störungen
Abstract
Zusammenfassung.Hintergrund: Krankheitsängste beziehen sich meist auf die Angst vor dem Leiden an somatischen Erkrankungen. In Einzelfallberichten wurden auch Ängste vor psychischen Störungen berichtet, jedoch bisher nicht systematisch untersucht. Psychotherapeut_innen sind ständig mit psychischen Erkrankungen konfrontiert. Fragestellung: Diese Studie untersucht, wie stark Krankheitsängste bei Psychotherapeut_innen ausgeprägt sind und welche Faktoren diese beeinflussen. Methoden: Insgesamt 239 Psychotherapeut_innen wurden per anonymer Onlinebefragung mit den Illness Attitude Scales und der Mini-Symptom-Checklist untersucht. Ergebnisse: Krankheitsängste bei Psychotherapeut_innen waren geringer ausgeprägt als in der Allgemeinbevölkerung und bei Psychologiestudierenden. Faktoren wie die allgemeine psychische Belastung und das Vorhandensein tatsächlicher Diagnosen gingen mit erhöhten Krankheitsängsten einher. Schlussfolgerungen: Krankheitsängste können sich nicht nur auf somatische Erkrankungen beziehen, sondern auch psychische Störungen betreffen. Eine stärkere Berücksichtigung psychischer Krankheitsängste und deren weitere systematische Erfassung erscheinen daher wünschenswert.
Abstract.Background: Illness anxiety is the fear of suffering from severe physical illnesses. Psychotherapists are constantly confronted with mental disorders. In individual case reports, anxiety related to suffering from mental disorders has also been documented but to date has not been systematically examined. Objectives: This study examines the strength of illness anxieties in psychotherapists and their influencing factors. Methods: We examined 239 psychotherapists using the Illness Attitude Scales and the Mini-Symptom-Checklist. Results: Illness anxieties in psychotherapists were significantly lower than those in the general population and psychology students. Variables like general mental stress and the presence of actual diagnoses correlated with higher illness anxieties. Conclusions: Illness anxiety is also present for mental disorders. Therefore, it is desirable to consider mental illness anxiety and its systematic detection.
Hypochondrie und Krankheitsangst
Die Angst oder Überzeugung, an einer schweren körperlichen Erkrankung zu leiden, wird im ICD-10 (Dilling & Freyberger, 2000) unter der Diagnose Hypochondrie klassifiziert. Die Ängste müssen seit mindestens sechs Monaten bestehen und trotz medizinischer Rückversicherung und fehlender entsprechender somatischer Befunde persistieren. Die Belastung der Betroffenen resultiert dabei aus der Bewertung körperlicher Symptome als Zeichen einer schweren Erkrankung, weniger aus somatischen Symptomen selbst. Die damit einhergehende Beeinträchtigung kann individuell unterschiedlich ausgeprägt sein und im schwersten Fall bis zur Arbeitsunfähigkeit, schweren depressiven Verstimmung oder stationärer Behandlung führen (Bleichhardt & Weck, 2015). Hypochondrische Patient_innen informieren sich entweder sehr häufig über die befürchtete Krankheit, konsultieren Ärzte und lassen sich wiederholt medizinisch untersuchen oder versuchen, dies komplett zu umgehen. Solche Sicherheits- und Vermeidungsverhaltensweisen können kurzfristig eine Entlastung schaffen, halten jedoch langfristig die Ängste aufrecht und führen mitunter zu enormen finanziellen Belastungen des Gesundheitssystems (Lee, Johnson, Harris & Sundram, 2016; Rask, Ørnbøl, Rosendal & Fink, 2017).
In epidemiologischen Studien ergeben sich häufig sehr unterschiedliche Prävalenzen für Hypochondrie. Je nach angelegten Diagnosekriterien, genutztem Diagnostikinstrument und untersuchter Personengruppe können sie von 0.0 % bis 4.5 % in der Allgemeinbevölkerung (gewichtetes Mittel: 0.40 %) und von 0.3 % bis 8.5 % (Mittelwert: 2.95 %) in klinischen Stichproben schwanken (Weck, Richtberg & Neng, 2014). In den bisherigen Studien wurden keine Geschlechtsunterschiede in der Auftretenshäufigkeit der Hypochondrie gefunden. Bei einer ausreichenden Kontrolle für das Vorliegen körperlicher Erkrankungen finden sich zudem keine Unterschiede zwischen Personen verschiedenen Alters (Weck et al., 2014).
Krankheitsängste bei somatisch Erkrankten
Neben dem Einfluss soziodemographischer Faktoren wurde in vorauslaufenden Studien auch die Rolle tatsächlicher Erkrankungen für die Ausprägung hypochondrischer Merkmale geprüft. Studien zur psychischen Gesundheit körperlich Erkrankter zeigen, dass diese neben affektiven Störungen (18 – 23 %) häufig unter Angststörungen leiden (19 – 25 %, Härter et al., 2007; Härter, Baumeister, Reuter, Wunsch & Bengel, 2002). Eine großangelegte, internationale Studie von Gureje, Üstün und Simon (1997) untersuchte 25 916 ambulante Patient_innen aus medizinischen Grundversorgungszentren in 14 Ländern, von denen 5 447 Personen nach einem allgemeinen Screening ein zweites Mal hinsichtlich hypochondrischer Merkmale untersucht wurden. Neben einer Prävalenzschätzung, die unter Anwendung der ICD-10 (Dilling & Freyberger, 2000) bei 0.8 % und bei Gebrauch weniger restriktiver Kriterien bei 2.2 % liegt, konnte gezeigt werden, dass somatisch erkrankte und gleichzeitig hypochondrische Patient_innen ihre Gesundheit als schlechter bewerteten und körperlich stärker beeinträchtigt waren. Bei somatisch Erkrankten wird die Angst durch das Vorhandensein der körperlichen Erkrankung zunächst als angemessen, und hinsichtlich der realen Bedrohung als nachvollziehbar und begründet bewertet. Krankheitsbezogene Ängste können dabei auch, beispielsweise hinsichtlich der Entwicklung eines gesünderen Lebensstils, funktional wirken, zugleich die Bewältigungskompetenzen des Individuums überschreiten und zu Leiden führen (Herschbach et al., 2001).
Exemplarisch seien an dieser Stelle zwei Untersuchungen erwähnt: Mabe und Kollegen (1988) erhoben Daten von 100 stationären Patient_innen mit verschiedenen körperlichen Erkrankungen und setzten den subjektiv wahrgenommenen Krankheitszustand in Bezug zu objektiven Gesundheitsdaten. Sie fanden, dass somatische Patient_innen häufig unter Krankheitsängsten und körperbezogenen Sorgen litten (Mabe, Hobson, Jones & Jarvis, 1988) und vermuteten, dass es vorübergehend zu einem hypochondrischen Status in Assoziation mit der akuten Erkrankung komme. Besonders einflussreich, auch hinsichtlich der Vorhersage hypchondrietypischer Aspekte, sei die emotionale Belastung der Patient_innen. Diese könne einerseits zu körperlichen Veränderungen führen, die folglich unzutreffend als Krankheitszeichen gedeutet werden oder andererseits zu einer alternativen Bewertung von Symptomen beitragen, denen zuvor keine besondere Aufmerksamkeit beigemessen wurde. In einer Längsschnittstudie untersuchten Robbins und Kirmayer (1996) 546 Patient_innen in der Erstversorgung einer allgemeinmedizinischen Universitätsklinik zum Zeitpunkt des ersten Besuchs und erneut ein Jahr danach. Sie unterteilten die Patient_innen anhand ihrer Angaben in krankheitsangstspezifischen Fragebögen in vier Gruppen (von „nicht hypochondrisch“ bis „dauerhaft hypochondrisch“). Bei den dauerhaft hypochondrischen Patient_innen zeigten sich zwar häufiger schwere medizinische Krankheitsanamnesen, jedoch unterschied sich die Schwere der aktuellen Erkrankung nicht von denen der nicht hypochondrischen Patient_innen. Bei den dauerhaft hypochondrischen Patient_innen bestand eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine komorbide Angststörung oder Depression (Robbins & Kirmayer, 1996).
Vorübergehende Krankheitsängste: Medical students’ disease
Zusätzlich zur kategorialen Betrachtung entsprechend der Kriterien der Diagnosesysteme kann man krankheitsbezogene Ängste anhand eines Spektrums von einem gänzlich fehlenden Krankheitsbewusstsein einerseits, über ein angemessenes Krankheitsbewusstsein als Normvariante, bis hin zu einem hypochondrischen Wahn andererseits abbilden (Bleichhardt & Weck, 2015; Schmidt, 1994). Dazwischen liegen vorübergehende hypochondrische Ängste. Diese bestehen meist kürzer als sechs Monate und können insbesondere in kritischen Lebenssituationen auftreten. Bereits in der 1960er Jahren wurden solche vorübergehenden Beschwerden vor allem bei Medizinstudierenden betrachtet (Hunter, Lohrenz & Schwartzman, 1964; Woods, Natterson & Silverman, 1966). Diese galten mit einer Prävalenz von bis zu 80 % bei den ansonsten psychisch und physisch gesunden Medizinstudierenden als so häufig, dass sie unter dem Begriff Medical students’ disease oder Medicalstudentitis (Woods et al., 1966) zusammengefasst wurden. Die im Rahmen der Medical students’ disease auftretenden Ängste wurden als Folge einer intensiven und emotional belastenden Beschäftigung mit entsprechend Krankheitsbildern im Medizinstudium bewertet und damit als Teil des Lernprozesses angesehen (Hunter et al., 1964; Woods et al., 1966). Dabei wurde im Selbstbericht der Studierenden deutlich, dass organische Erkrankungen doppelt so oft befürchtet wurden als psychische Erkrankungen (Woods et al., 1966).
Studien ab den 1980er Jahren konnten diese Effekte nicht ohne Weiteres replizieren (Howes & Salkovskis, 1998). So war beispielsweise das Vorliegen der Ängste abhängig vom Zeitpunkt der Erfassung, da die emotionale Belastung vor allem zu Beginn des Medizinstudiums ausgeprägt ist (Baric & Trkulja, 2012; Moss-Morris & Petrie, 2001; Waterman & Weinman, 2014). Zudem zeigten anschließende Studien, dass bei den Studierenden der Medizin mitunter sogar geringere Hypochondriewerte auftraten als bei Kontrollgruppen (Singh, Hankins & Weinman, 2004). Letztendlich wurde festgehalten, dass krankheitsbezogene Ängste bei Medizinstudierenden zunächst aufgrund ihrer klinischen Erfahrungen und verstärkten Auseinandersetzung mit Symptomen zunahmen, um dann nachfolgend durch eine gelungene kognitive Einordnung in Abhängigkeit des Wissenstandes wieder abzunehmen (Barić & Trkulja, 2012; Singh, 2006). Aktuelle Studien zur Belastung von Studierenden ermitteln zunehmende Raten psychischer Störungen und zeigen Lebenszeitprävalenzen von bis zu 35 % bzw. 12-Monatsprävalenzen von 31 % für mindestens eine psychische Störung auf (Auerbach et al., 2018).
Der Frage, ob ähnliche Effekte vorübergehender krankheitsbezogener Ängste auch bei Psychologiestudierenden während des Studiums auftreten, ging die Studie von Roth-Rawald und Kollegen (2020) nach. Insgesamt 75 Studierende der Psychologie und als Kontrollgruppe 71 Studierende der Bildungswissenschaften wurden hinsichtlich ihrer Ängste vor somatischen und psychischen Erkrankungen befragt. Dabei wurde ein besonderes Augenmerk auf das Vorliegen von Ängsten hinsichtlich psychischer Störungen gelegt, da sich Psychologiestudierende während des Studiums intensiv mit eben jenen Störungen beschäftigen.
Ängste vor psychischen Erkrankungen
Auf der Grundlage der Illness Attitude Scales (Hiller & Rief, 2004), einem etablierten Verfahren zur Erfassung hypochondrischer Störungen, wurde eigens ein Fragebogen zur Erfassung der Angst vor psychischen Erkrankungen entwickelt. Dafür wurde die Formulierung einzelner Items (bspw. „Haben Sie Angst, Sie könnten Krebs haben?“) entsprechend der Gegebenheiten psychischer Störungen adaptiert (bspw. „Haben Sie Angst, Sie könnten eine Depression haben?“). Es zeigte sich, dass krankheitsbezogene Ängste bei Psychologiestudierenden nicht stärker ausgeprägt waren als bei Studierenden anderer Fachrichtungen. Die Ängste vor körperlichen Erkrankungen waren auch bei Psychologiestudierenden häufiger als Ängste vor psychischen Störungen. Die Ängste vor psychischen Störungen unterlagen darüber hinaus keiner zeitlichen Veränderung über ein Semester hinweg. Folglich zeigen Psychologiestudierende entgegen der aus der Forschung zur Medical students’ disease abgeleiteten Annahme trotz der Beschäftigung mit psychischen Störungen keine verstärkten Ängste vor einer psychischen Erkrankung (Roth-Rawald et al., 2020).
Im Zuge dieser ersten systematischen Untersuchung psychischer Krankheitsängste, die über die bisherige, seltene Darstellung von Einzelfallberichten hinausging, ergaben sich weitere Fragestellungen. So wurde beispielsweise nicht für das Vorhandensein tatsächlicher somatischer oder psychischer Erkrankungen kontrolliert. Außerdem wurden bisher lediglich Studierende der Psychologie hinsichtlich ihrer Krankheitsängste untersucht. Ein großer Teil der theoretischen und praktischen Auseinandersetzung von Psycholog_innen mit klinischen Inhalten und psychischen Störungen findet zugleich erst nach dem Studium in der weiterführenden Ausbildung zum / zur Psychotherapeut_in statt.
Psychische Gesundheit von Psychotherapeut_innen
Im Gegensatz zu einem umfangreichen Wissen über die psychische Gesundheit der Allgemeinbevölkerung gibt es nur wenige Studien zur psychischen Gesundheit von psychotherapeutisch tätigen Berufsgruppen. Psychotherapeut_innen sind darin ausgebildet, anderen bei der Bewältigung von Belastungen zu helfen. Nichts desto trotz besteht bei dieser emotional anfordernden Tätigkeit ein Risiko, eigene Belastungen nicht hinreichend zu erkennen, bevor diese die eigene Gesundheit und Qualität der Arbeit beeinflussen (American Psychology Association APA, 2010). Zu den Belastungsfaktoren in der therapeutischen Arbeit zählen beispielsweise suizidale oder aggressive Patient_innen, die wiederholte Auseinandersetzung mit emotional intensiven Themen, das Sich-Sorgen um die Klient_innen, berufliche oder emotionale Isolation, der Druck, therapeutische Ziele zu erreichen oder Verwaltungs- und Dokumentationsanforderungen (APA, 2010; Smith & Moss, 2009). Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung zeigen im Gesundheitssystem tätige Berufsgruppen ein höheres Stresserleben, höhere Depressionswerte und ein erhöhtes Suizidrisiko, wobei sich letzteres deutlicher bei Psychiatern als bei anderen Ärzten zeigt (Hawton, Agerbo, Simkin, Platt & Mallanby, 2011; Hawton, Clements, Sakarovitch, Simkin & Deeks, 2001; Reimer, 2006). Zwei Drittel der klinisch tätigen Psycholog_innen litten in ihrem Leben selbst schon an mindestens einer psychischen Störung (Gilroy, Caroll & Murra, 2002, Pope & Tabachnick, 1994; Tay, Alcock & Scior, 2018). Am häufigsten wurden leichte und mittelschwere Depressionen (70 %) und Angststörungen (42 %) benannt (Tay et al., 2018). 60 % der befragten Psycholog_innen in der Studie von Pope und Tabachnick gaben an, schon einmal gearbeitet zu haben, obwohl sie zu gestresst waren, um eine hilfreiche Therapie anzubieten. Zusätzlich können Faktoren wie das Herunterspielen oder Ignorieren von Symptomen und das Vermeiden von Hilfe aus Scham oder Angst vor Stigmatisierung zur Verschlimmerung der Symptomatik beitragen und das Funktionsniveau der Psychotherapeut_innen einschränken (APA 2010, Health and Care Professions Council, 2015). Umso wichtiger scheint es, auch vor dem Hintergrund ethischer und berufsrechtlicher Verpflichtungen, dass Psychotherapeut_innen Belastungen und Symptome wahrnehmen und zeitnah Fürsorge für ihre psychische Gesundheit leisten.
Fragestellung
Das Ziel dieser Studie lag darin, krankheitsbezogene Ängste und Belastungen bei Psychotherapeut_innen (PT) zu untersuchen. Die Gesamtgruppe der PT unterteilte sich in approbierte Psychotherapeut_innen (PP) und Psychotherapeut_innen in Ausbildung (PiA). Aufgrund der mit dem Begriff Hypochondrie einhergehenden Stigmata und den Veränderungen in den Diagnosekriterien und Bezeichnungen innerhalb des DSM-5 (American Psychiatric Association APA, 2013) wird entsprechend der dimensionalen Betrachtungsweise der Begriff Krankheitsangst präferiert. Dieser bezeichnet im Folgenden die Angst vor dem Erkranken an schwerwiegenden Krankheiten, ohne zwingend alle Kriterien der Diagnose der Krankheitsangststörung zu erfüllen. Anhand der dargestellten Ergebnisse bisheriger Studien zu somatischen Krankheitsängsten und darüber hinausgehender explorativer Überlegungen lassen sich folgende konkrete Fragestellungen und Hypothesen ableiten:
- 1.Gibt es Unterschiede in der Ausprägung psychischer und somatischer Krankheitsängste zwischen Psychologiestudierenden, PiA und PP (u. a. Hunter et al., 1964; Woods et al., 1966)?
- a.Die somatischen Krankheitsängste unterscheiden sich nicht zwischen den Gruppen.
- b.Die psychischen Krankheitsängste unterscheiden sich zwischen den Gruppen und sollten bei den PP am niedrigsten sein.
- 2.Gibt es weitere Faktoren, die einen Einfluss auf die Krankheitsängste haben?
- a.Soziodemographische Variablen: Das Geschlecht und das Alter beeinflussen die Krankheitsängste nicht (Weck et al., 2014).
- b.Therapiebezogene Variablen: Der Ausbildungsstand und die Berufserfahrung beeinflussen die Ausprägung der Krankheitsängste (u. a. Barić & Trkulja, 2012; Singh, 2006).
- c.Krankheitsbezogene Variablen: Das Vorhandensein einer somatischen Erkrankung beeinflusst die Höhe der somatischen Krankheitsängste, nicht jedoch der psychischen Krankheitsängste (u. a. Mabe et al., 1988, Robbins & Kirmayer, 1996). Das Vorhandensein einer psychischen Erkrankung beeinflusst die Höhe der psychischen Krankheitsängste, jedoch nicht die der somatischen Krankheitsängste. Die allgemeine psychische Belastung beeinflusst die Höhe sowohl der somatischen als auch psychischen Krankheitsängste (u. a. Hawton et al., 2001; Hawton et al., 2011).
Methode
Stichprobe und Datenerhebung
Insgesamt nahmen an dieser Studie 245 PT teil. In die Auswertung eingeschlossen wurden die Daten von allen Teilnehmenden (n = 239), die angaben, approbierte Therapeut_innen (PP: n = 55) oder Therapeut_innen in Ausbildung zu sein (PiA: n = 184). Die Datenerhebung für diese Studie fand als Onlineerhebung im Zeitraum von Juni 2019 bis April 2020 statt. Der Aufruf zur Studie wurde dabei mittels Schneeballsystem an bekannte psychotherapeutisch Tätige verschickt. Zudem wurden Ausbildungsinstitute angeschrieben, die den Aufruf an ihre Ausbildungskandidat_innen weiterleiteten. Im Studienaufruf wurde erklärt, dass jede_r psychotherapeutisch Tätige an der Studie teilnehmen kann. Die Teilnahme war freiwillig und anonymisiert. Die Befragung wurde vorab vom Datenschutzbeauftragten der Universität positiv begutachtet. Zu Beginn der Studie wurde die Profession mittels Auswahlmenü erhoben. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Befragung betrug 6.42 Minuten (SD = 1.88 Minuten, Range: 3.05 – 15.38 Minuten). Die Daten der Psychologiestudierenden (n = 75), mit denen die Angaben der PT zur Beantwortung der Fragestellungen verglichen wurden, wurden im Wintersemester 2017/18 Paper-Pencil-basiert im Rahmen einer Vorlesung an der Universität erhoben und in einer vorangegangenen Veröffentlichung berichtet (Roth-Rawald et al., 2020).
Erhebungsinstrumente
Illness Attitude Scales – IAS. Die IAS sind ein von Kellner (1986) entwickeltes und von Hiller und Rief (2004) für den deutschsprachigen Raum adaptiertes Screeninginstrument zur Erfassung krankheitsängstlicher Erlebens- und Verhaltensweisen. Die IAS wurden ausgewählt, da sie ein reliables und valides Erhebungsinstrument zur Erfassung von Krankheitsängsten und Krankheitsverhalten darstellen und eine weite Verbreitung haben. Der Fragebogen besteht insgesamt aus 29 Items, von denen in dieser Studie die 27 fünfstufigen Items verwendet wurden (Hiller, Rief & Fichter, 2002). Die interne Konsistenz der IAS liegt im guten bis sehr guten Bereich (für den IAS-Gesamtwert: Test-Retest-Reliabilität zwischen r = .89 und r = .93, Cronbachs Alpha von α = .90, Hiller & Rief, 2004). In dieser Studie konnte für die Reliabilität ein Cronbachs Alpha von α = .85 ermittelt werden.
Illness Attitude Scales, Variante zur Erfassung der Krankheitsängste vor psychischen Störungen – IAS-p. Da sich die IAS (Kellner, 1986) ausschließlich auf die Angst vor somatischen Erkrankungen beziehen, wurde mit den IAS-p eine Version zur Erfassung der Angst vor psychischen Störungen entwickelt (Roth-Rawald et al., 2020). Die im Rahmen dieser Studie genutzte Kurzversion der IAS-p besteht aus 12 Items, die äquivalent zu den IAS auf einer fünfstufigen Skala von 0 (= „nein“ / „fast nie“ / „keine“) bis 4 (= „meistens“) beantwortet werden können. Die Reliabilität für die Kurzversion lag in dieser Studie bei α = .92.
Mini-Symptom-Checklist – Mini-SCL. Die Mini-SCL (Franke, 2017) ist ein Screening-Instrument zur Erfassung der allgemeinen psychischen Belastung. Jeweils sechs Items auf den drei Subskalen Depressivität, Ängstlichkeit und Somatisierung erfragen das Auftreten bestimmter Symptome während der letzten sieben Tage. Die Antworten erfolgen auf einer fünfstufigen Skala von 0 (= „überhaupt nicht“) bis 4 (= „sehr stark“). Zusätzlich zu den Skalenwerten lässt sich ein globaler Kennwert (GSI) für die psychische Belastung berechnen. Für den GSI liegen interne Konsistenzen von α = .93, für die Subskalen Somatisierung von α = .82, Depressivität von α = .87 und Ängstlichkeit von α = .84 vor (Franke et al., 2017). In dieser Studie konnte für die Reliabilität ein Wert von α = .84 ermittelt werden.
Darüber hinaus wurden die Teilnehmenden in einem allgemeinen Fragenteil gebeten, Auskunft hinsichtlich soziodemographischer (Geschlecht, Altersgruppe), berufsbezogener (Ausbildungsstand, Berufserfahrung, Patient_innenkontakt, behandelte Patient_innengruppe) und krankheitsspezifischer Variablen (vorhandene psychische und somatische Diagnosen) zu geben.
Datenauswertung
Die statistischen Analysen wurden mit dem Programm IBM SPSS Statistics 27.0 durchgeführt. Die Hypothesen wurden auf einem zweiseitigen Signifikanzniveau von α = 5 % getestet. Als Reliabilitätskriterium wurden die internen Konsistenzen mit Hilfe von Cronbachs Alpha überprüft (Cronbach, 1951). Ein Wert von .70 bis .80 gilt als Hinweis für eine zufriedenstellende Reliabilität (Bland & Altman, 1997). Neben den deskriptiven Analysen wurden zur Prüfung der Hypothesen zu den Gruppenunterschieden in den somatischen (Gesamtwert IAS) und psychischen Krankheitsängsten (Gesamtwert IAS-p) aufgrund fehlender Normalverteilung (Shapiro-Wilk-Test p < .05) nonparametrische Verfahren (Kruskal-Wallis-H-Test) genutzt. Als Post-hoc-tests wurden Dunn-Bonferroni-Tests durchgeführt (Bland & Altman, 1995). Effektstärken werden mit Cohens d angegeben (Cohen, 1988). Für den Vergleich der Ausprägung somatischer Krankheitsängste der hiesigen Stichprobe der PT mit dem für die Grundgesamtheit der deutschen Allgemeinbevölkerung feststehenden Mittelwert wurde ein Einstichproben-t-Test genutzt. Die Zusammenhänge der Krankheitsängste mit der psychischen Belastung werden mit Pearson Korrelationskooeffizienten (r) berichtet.
Um den Einfluss weiterer Faktoren auf die Krankheitsängste zu analysieren, wurden multiple Regressionsanalysen durchgeführt. Die Effektstärken werden mit f nach Cohen (1992) angegeben. Die notwendigen Voraussetzungen, wie die Unabhängigkeit der Residuen, keine Multikollinearität oder Homoskedastizität und Normalverteilung der Residuen wurden überprüft. Eingeschlossen wurden folgende Prädiktorvariablen (hierarchisch, schrittweise):
- •Block 1 Soziodemographische Variablen: Geschlecht (männlich / weiblich), Alter (≤ 25 / 26 – 35 / 36 – 45 / ≥ 46 Jahre),
- •Block 2 Therapiebezogene Variablen: Ausbildungsstand (Studierende / Psychotherapeut_innen in Ausbildung / approbierte Psychotherapeut_innen), Berufserfahrung (in Jahren),
- •Block 3 Krankheitsbezogene Variablen: Somatische Diagnose (ja / nein), psychische Diagnose (ja / nein), psychische Belastung (GSI der Mini-SCL).
Ergebnisse
Die demographischen Charakteristika der Stichprobe sind in Tabelle 1 dargestellt.

18 % (n = 43) der Studienteilnehmenden gaben an, an einer somatischen Diagnose erkrankt zu sein. Am häufigsten wurden Erkrankungen der Schilddrüse genannt (26 %), gefolgt von Erkrankungen des Atmungssystems (16 %). 7 % (n = 7) der Befragten litten an einer psychischen Diagnose, wobei am häufigsten affektive Störungen angegeben wurden (F3, 50 %), gefolgt von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen (F4, 22 %). Hinsichtlich der von den Teilnehmenden befürchteten Krankheiten wurden zudem die Antworten der Items betrachtet, die die Angst vor konkreten Erkrankungen erfragen. Wertet man die Antworten „selten“ / „manchmal“ / „oft“ / „meistens“ auf die Frage „Haben Sie Angst, Sie könnten … haben?“ als grundsätzlich zutreffend im Vergleich zum direkten „nein“, dann bejahten 51 % (n = 123) der Teilnehmenden die Angst vor Krebs (M = 0.70, SD = 0.80, Wertebereich 0 – 3). 23 % (n = 56) der Teilnehmenden bejahten die Angst vor einer Herzerkrankung (M = 0.31, SD = 0.63). 45 % (n = 108) der Teilnehmenden bejahten die Angst vor einer Depression und / oder Manie (M = 0.71, SD = 0.91) und 33 % (n = 78) vor einer Angsterkrankung (M = 0.52, SD = 0.88). Bei den freien Nennungen wurde bei den somatischen Erkrankungen zusätzlich am häufigsten die Furcht vor einem Gehirntumor, vor Augen- oder Lungenerkrankungen, vor Sterilität oder einem Schlaganfall benannt. Bei den psychischen Erkrankungen wurde – trotz der Frage nach weiteren anderen als den genannten Erkrankungen – mehrfach Depression oder Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitäts-Störung angegeben.
Krankheitsängste bei Psychotherapeut_innen
Die Mittelwerte des Gesamtwertes der IAS, des Gesamtwertes der IAS-p und des GSI der Mini-SCL sowie die entsprechenden Standardabweichungen sind in Tabelle 2 dargestellt. Der Vergleich mit dem für die Allgemeinbevölkerung feststehenden Wert somatischer Krankheitsängste (Gesamtwert der IAS: MIAS = 33.57, SD = 16.15, Weck et al. 2010) ergab, dass die Gesamtheit der PT signifikant geringer ausgeprägte somatische Krankheitsängste angab (t [238] = -9.91, p < .001, |d| = 0.64).

Die zur Testung potentieller Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen durchgeführten Kruskal-Wallis-Tests ergaben, dass die somatischen Krankheitsängste je nach Ausbildungsstand variieren (Χ2 = 13.53, p < .001). Folgend durchgeführte Post-hoc-Tests (Dunn-Bonferroni-Tests) zeigen, dass sich die Werte der Studierenden und PiA (z = 2.85, p = .013, |d| = 0.36) sowie die Werte der Studierenden und PP (z = 3.51, p < .001, |d| = 0.61) signifikant voneinander unterscheiden nicht jedoch die der PiA von jenen der PP (z = 1.51, p = .395).
Die psychischen Krankheitsängste (Gesamtwert IAS-p) unterschieden sich ebenso zwischen den Gruppen (X2 = 13.98, p < .001). Im paarweisen Vergleich liegen signifikante Unterschiede zwischen den Studierenden und PP (z = 3.70, p < .001, |d| = 0.28) sowie zwischen den PiA und PP (z = 2.86, p = .013, |d| = 0.42) vor, nicht jedoch zwischen Studierenden und PiA (z = 1.59, p = .335).
Die allgemeine psychische Belastung zeigt ebenso Unterschiede zwischen den Berufsgruppen (Χ2 = 16.13, p < .001), wobei wie bei den psychischen Krankheitsängsten zwischen den Studierenden und PP (z = 4.00, p < .001, |d| = 0.59) sowie den PiA und PP (z = 2.98, p = .009, |d| = 0.32) signifikante Unterschiede vorliegen, nicht aber zwischen Studierenden und PiA (z = 1.85, p = .194).
Darüber hinaus wurden die Zusammenhänge zwischen der Ausprägung der jeweiligen Krankheitsängste und der allgemeinen psychischen Belastung aller Teilnehmenden betrachtet. Die Korrelation zwischen dem IAS-Gesamtwert und dem GSI betrug r = .44 (|d| = 0.98), zwischen dem IAS-p-Gesamtwert und dem GSI r = .62 (|d| = 1.58), zwischen dem IAS-Gesamtwert und dem IAS-p-Gesamtwert r = .50 (|d| = 1.15). Alle Korrelationen waren auf einem Niveau von p < .01 signifikant.
Vorhersage somatischer Krankheitsängste
Die Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse, in der alle Variablen wie zuvor beschrieben hierarchisch und schrittweise Berücksichtigung fanden, sind in Tabelle 3 dargestellt. Es zeigt sich, dass nur das Vorhandensein einer somatischen Diagnose und die psychische Belastung (GSI der Mini-SCL) einen Einfluss auf die Angst vor somatischen Erkrankungen (IAS) haben (F(2,231) = 30.88, p < .001). Insgesamt können in diesem Modell 21 % der Streuung durch diese zwei Variablen erklärt werden. Das entspricht einer Effektstärke von f = 0.52 (|d| = 1.04) und stellt somit einen starken Effekt dar.

Vorhersage psychischer Krankheitsängste
Hinsichtlich der psychischen Krankheitsängste (IAS-p) ist aus Tabelle 3 ersichtlich, dass zunächst das Geschlecht der Befragten (weiblich > männlich) und der Ausbildungsstand approbierte_r Therapeut_in im Vergleich zum Ausbildungsstand Studierende_r (Therapeut_in < Studierende) einen signifikanten Beitrag zur Aufklärung der Varianz leisten (Modell 2: F(2,231) = 6.35, p = .002). Durch dieses Modell werden jedoch lediglich 4 % der Streuung erklärt (f = 0.20, |d| = 0.40). Unter Hinzunahme der Variablen allgemeine Belastung (GSI) und Vorhandensein einer psychischen Erkrankung bleibt nur noch das Geschlecht als zusätzlicher Prädiktor signifikant. Zugleich steigt die Aufklärung auf 41 % (Modell 4: (F(4,231) = 41.02, p < .001), was einer Effektstärke von f = 0.82 (|d| = 1.64) entspricht und folglich einen starken Effekt repräsentiert. Ein weibliches Geschlecht, eine vorhandene psychische Erkrankung und eine höhere psychische Belastung gehen mit stärker ausgeprägten psychischen Krankheitsängsten einher.
Diskussion
Diese Studie hatte zum Ziel, die aus der vorangegangenen Untersuchung (Roth-Rawald et al., 2020) offen gebliebenen Fragen im Zusammenhang mit den erstmals systematisch untersuchten psychischen Krankheitsängsten zu adressieren. Es wurde betrachtet, inwiefern sich Krankheitsängste zwischen den psychotherapeutisch tätigen Gruppen verschiedenen Ausbildungsstandes unterscheiden und welche Rolle demographische Variablen, wie das Alter, das Geschlecht oder die Berufserfahrung der Behandler_innen, spielen. Zudem wurde das Vorhandensein tatsächlicher psychischer oder somatischer Erkrankungen als beeinflussender Faktor der Ausprägung der Krankheitsängste untersucht.
Der Vergleich zwischen den verschiedenen Ausbildungsständen zeigte die jeweils am stärksten ausgeprägten somatischen und psychischen Krankheitsängste und die höchste allgemeine psychische Belastung bei den Studierenden. Die geringsten Krankheitsangstausprägungen und Belastungswerte lagen bei den PP vor. Auch wenn Untersuchungen im Längsschnitt noch ausstehen, könnte angenommen werden, dass ein zunehmender Ausbildungsstand in bedeutsamer Weise mit geringeren Krankheitsängsten einhergeht. Dieses Bild zeigte sich auch in den auf die ursprünglichen Studien zur Medical students’ disease (Hunter et al., 1964; Woods et al., 1966) folgenden Untersuchungen (Moss-Morris & Petrie, 2001; Singh et al., 2004). In diesen wurde deutlich, dass somatische Krankheitsängste im Verlauf der Ausbildung variieren, d. h. zu Beginn stärker ausgeprägt sind als im weiteren Verlauf.
Darüber hinaus sind Studierende eine Bevölkerungsgruppe, die in einer Vielzahl von Studien eine deutlich erhöhte psychische Belastung aufzeigen (Auerbach et al. 2018; Weber, Ehrenthal, Pförtner, Albus & Stosch, 2020). Die psychische Belastung hat gleichzeitig den stärksten Einfluss auf die Krankheitsängste. Die stärker ausgeprägten Krankheitsängste bei Studierenden könnten demzufolge auch Ausdruck einer stärkeren Belastung sein, die zu mehr Symptomen führt, um die sie sich wiederum Sorgen machen könnten. Es ist zudem nicht auszuschließen, dass stärker belastete Studierende gar nicht erst die Weiterbildung zum / zur Psychotherapeut_in beginnen, wodurch die reduzierten Krankheitsängste auch durch Selbstselektionseffekte mitbedingt sein könnten. Insgesamt sind PT deutlich weniger krankheitsängstlich als die Allgemeinbevölkerung, für die repräsentative Normwerte vorliegen, zumindest was somatische Erkrankungen betrifft. Dies unterstützt die These, dass Fachwissen auch zur Reduktion entsprechender Krankheitsängste beitragen könnte (Singh, 2006). Die Berufserfahrung, definiert als Arbeitszeit im klinischen Bereich seit dem grundständigen Studium, hatte in dieser Untersuchung jedoch keinen signifikanten Einfluss auf Krankheitsängste. Wenn ein höherer Ausbildungsstand mit geringeren Ängsten einhergeht, dann könnte es sein, dass Krankheitsängste bei approbierten Psychotherapeut_innen bereits so gering ausgeprägt sind, dass selbst mit zunehmender Berufserfahrung keine signifikante Verbesserung mehr stattfindet. Insgesamt scheint, wie bei der Medical students’ disease, der Zeitpunkt der Befragung die entscheidende Rolle bei der Einschätzung der Ausprägung des Effektes zu haben (Baric & Trkulja, 2012; Moss-Morris & Petrie, 2001; Waterman & Weinman, 2014).
Zudem wurden weitere Einflussfaktoren untersucht. Das Geschlecht und Alter der Befragten hatten keinen Einfluss auf die somatischen Krankheitsängste, was bisherigen Erkenntnissen zur Prävalenz von Krankheitsängsten entspricht (Weck et al., 2014). Psychische Krankheitsängste waren bei Frauen wiederum signifikant stärker ausgeprägt. Das könnte gegebenenfalls im Zusammenhang mit der grundsätzlich höheren Prävalenz psychischer Erkrankungen bei Frauen, ihrem häufigeren Erkranken an internalisierenden Störungen und der stärkeren Inanspruchnahme therapeutischer Hilfe stehen (Beutel, Brähler & Tibubos, 2019; Merbach & Brähler, 2018; Sieverding, 1999). Das Vorhandensein einer somatischen Diagnose beeinflusst die Angst vor somatischen Erkrankungen signifikant. Gleiches gilt für das Vorhandensein einer psychischen Diagnose und die Angst vor psychischen Erkrankungen, jedoch nicht vice versa. Dieser Befund steht im Einklang mit Erkenntnissen aus vorauslaufenden Studien, die somatisch Erkrankte untersuchten. Diese zeigten, dass somatisch Erkrankte häufig zusätzlich unter psychischen Störungen, insbesondere Angststörungen, litten (Härter et al., 2002, Härter et al., 2007). Zudem können kognitive Prozesse, wie eine verstärkte Aufmerksamkeitslenkung auf körperliche Symptome und deren Fehlbewertung als Anzeichen einer Erkrankung, die bei Patient_innen mit somatischen Erkrankungen stärker ausgeprägt sind, als mitursächlich für höhere Krankheitsangstwerte betrachtet werden (Gureje et al., 1997, Herschbach et al., 2001, Mabe et al., 1988).
Blickt man auf die genannten Studien zur psychischen Gesundheit von Psychotherapeut_innen und Psychiater_innen zurück (Gilroy et al., 2002; Hawton et. al, 2001; Hawton et al., 2011, Tay et al., 2018), werden darin hohe Belastungsfaktoren beschrieben. Hohe Belastungswerte gehen wiederum mit höheren Krankheitsangstwerten einher. Gleichzeitig zeigte sich, dass die Krankheitsängste von Psychotherapeut_innen im Vergleich zu Studierenden und der Allgemeinbevölkerung (bei somatischen Krankheitsängsten) am niedrigsten ausgeprägt waren. Dem zu erwartenden Effekt höherer Krankheitsängste bei höherer Belastung könnten somit weitere Bewältigungskompetenzen entgegenwirken. Psychotherapeut_innen könnten bspw. einen besseren Zugang zu Unterstützungsangeboten haben, durch Intervision und Selbsterfahrung vorhandene Belastungen reduzieren oder insgesamt im Vergleich zu Studierenden weniger unsichere Lebensumstände und mehr hilfreiche Ressourcen zur Verfügung haben.
Limitationen und Ausblick
Diese Studie wurde als Onlinebefragung durchgeführt. Aufgrund des Formats und der Anonymität der Befragung ist davon auszugehen, dass sowohl die Zuverlässigkeit als auch die Gültigkeit der Angaben ausreichend hoch sind. Trotz der großen Reichweite sind dabei naturgemäß die Kontrolle von Selbstselektionseffekten oder eine Überprüfung der Korrektheit der Angaben der Teilnehmenden nicht möglich.
Mit der Untersuchung von PT sind neben den Psychologiestudierenden weitere Professionen in die Betrachtung der psychischen Krankheitsängste einbezogen worden. Auf der Grundlage des angenommen, unterschiedlich stark ausgeprägten Fachwissens werden Annahmen über den Verlauf von Krankheitsängsten getroffen. Zusätzlich zu solch querschnittlichen Untersuchungen wären Studien im Längsschnitt, die zusätzlich das tatsächlich vorhandene Wissen der Teilnehmenden explizit eruieren, wünschenswert.
Die Validierung und Normierung der IAS-p zur Erfassung psychischer Krankheitsängste stehen noch aus. Es kann darüber hinaus bisher nicht vollends ausgeschlossen werden, dass die Formulierung einzelner Items der IAS (bspw. „Machen Sie sich Sorgen um ihre Gesundheit?“) bzw. IAS-p („Machen Sie sich Sorgen über Ihre psychische Gesundheit?“) dazu beitragen könnte, dass Patient_innen mit psychischen oder somatischen Erkrankungen diese systematisch stärker beantworten.
Bei der Untersuchung der potentiellen Einflussfaktoren auf die Krankheitsängste, wie dem behandelten Patient_innenklientel (Erwachsene vs. Kinder- und Jugendliche) oder dem aktuellen Kontakt zu Patient_innen resultierten teils kleine Stichproben, um ausreichend Power zur Entdeckung bedeutsamer Effekte zu haben. Für weitere Analysen wären daher zum einen die Untersuchung größerer Stichproben sinnvoll, zum anderen der Einbezug zusätzlicher Variablen, wie weitere Berufsgruppen (bspw. Psychiater_innen, Ärztliche Psychotherapeut_innen) oder unterschiedliche Vertiefungsrichtungen (dynamische Verfahren vs. Verhaltenstherapie). Dabei sollte die Erhebung der Variablen, bspw. des Alters (hier kategorial erfasst), dahingehend überdacht werden, so wenig wie möglich Varianz zu verlieren und dabei gleichzeitig im Einklang mit datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu stehen.
Fazit für die Praxis
Ängste vor psychischen Erkrankungen werden von Patient_innen im klinischen Alltag von Zeit zu Zeit berichtet. Es lag bisher kein Instrument zur systematischen und ökonomischen Erfassung dieser Ängste vor. Die IAS-p können insbesondere bei Patient_innen, die mit Angststörungen im Allgemeinen oder (somatischen) Krankheitsängsten im Speziellen vorstellig werden, eingesetzt werden, um die Sichtbarkeit der Symptomatik zu erhöhen und die Versorgung betroffener Patient_innen zu verbessern. Neben der Relevanz für die Patient_innen besteht ein Nutzen für psychotherapeutisch tätige Berufsgruppen. Die Ergebnisse zeigen, dass der Ausbildungsstand und die Belastung Einfluss auf die Ausprägung ihrer Krankheitsängste haben. Dahingehend könnten Angebote zur Bewältigung von Ängsten und zur Unterstützung der Selbstfürsorge der PT angeboten werden.
Literatur
(2010). Survey findings emphasize the importance of self-care for psychologists. Verfügbar unter: https://www.apapracticecentral.org/update/2010/08-31/survey.aspx
(2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition. Washington, DC: American Psychiatric Association. https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596
(2018). The WHO world mental health surveys international college student project: prevalence and distribution of mental disorders. Journal of Abnormal Psychology, 127, 623 – 38. https://doi.org/10.1037/abn0000362
(2012). Declining health anxiety throughout medical studies: It is mainly about a more relaxed perception of the health-related concerns. Medical Teacher, 34, 1056 – 63. https://doi.org/10.3109/0142159X.2012.716180
(2019).
Gender und psychische Gesundheit – Bedeutung für die psychotherapeutische Praxis . In: I. Moeslein-TeisingG. SchäferR. Martin (Hrsg.), Geschlechter-Spannungen (S. 54 – 66). Gieβen: Psychosozial-Verlag.(1995). Multiple significance tests: The Bonferroni method. British Medical Journal, 21, 170. https://doi.org/10.1136/bmj.310.6973.170
(1997). Cronbach’s alpha. British Medical Journal, 314, 572. https://doi.org/10.1136/bmj.314.7080.572
(2015). Kognitive Verhaltenstherapie bei Hypochondrie und Krankheitsangst. Berlin, Heidelberg: Springer.
(1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum Associates.
(1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112, 155 – 9. https://doi.org/10.1037//0033-2909.112.1.155
(1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297 – 334. https://doi.org/10.1007/BF02310555
(2000). Taschenführer zur Klassifikation psychischer Störungen. Bern: Huber.
(2017). Mini-SCL. Mini-Symptom-Checklist. Göttingen: Hogrefe.
(2017). Psychometric analysis of the brief symptom inventory 18 (BSI-18) in a representative german sample. BMC Medical Research Methodology, 17, 14. https://doi.org/10.1186/s12874-016-0283-3
(2002). A preliminary survey of counseling psychologist’ personal experiences with depression and treatment. Professional Psychology, Research and Practice, 33, 402 – 407. https://doi.org/10.1037/0735-7028.33.4.402
(1997). The syndrome of hypochondriasis: a cross-national study in primary care. Psychological Medicine, 27, 1001 – 1010. https://doi.org/10.1017/s0033291797005345
(2007). Increased 12-month prevalence rates of mental disorders in patients with chronic somatic diseases. Psychotherapie und Psychosomatics, 76, 354 – 360. https://doi.org/10.1159/000107563
(2002). Epidemiologie komorbider psychischer Störungen bei Rehabilitanden mit muskuloskelettalen und kardiovaskulären Erkrankungen. Rehabilitation, 41, 367 – 374. https://doi.org/10.1055/s-2002-36279
(2011). Risk of suicide in medical and related occupational groups: A national study based on Danish case populationbased registers. Journal of Affective Disorders, 134, 320 – 326. https://doi.org/10.1016/j.jad.2011.05.044
(2001). Suicide in doctors: a study of risk according to gender, seniority and speciality in medical practitioners in England and Wales, 1979 – 1995. Journal of Epidemiology and Community Health, 55, 296 – 300. https://doi.org/10.1136/jech.55.5.296
(2015). Standards of proficiency–practitioner psychologists. London: HCPC.
(2001). Diagnostik von Progredienzangst. Entwicklung eines Fragebogens zur Erfassung von Progredienzangst bei Patienten mit Krebserkrankungen, Diabetes mellitus, und entzündlich-rheumatischen Erkrankungen in der Rehabilitation. München: Technische Universität, Institut für Psychosomatische Medizin, medizinische Psychologie und Psychotherapie.
(2004). Internationale Skalen für Hypochondrie: Deutschsprachige Adaption des Whiteley-Index (WI) und Illness Attitude Scales (IAS). Göttingen: Hogrefe.
(2002). Dimensional and categorial approaches to hypochondriasis. Psychological medicine, 32, 707 – 18. https://doi.org/10.1017/S0033291702005524
(1998). Health anxiety in medical students. Lancet, 351, 1332. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)79059-0
(1964). Nosophobia and hypochondriasis in medical students. The Journal of Nervous and Mental Disease, 139, 147 – 52. https://doi.org/10.1097/00005053-196408000-00008
(1986). Somatization and hypochondriasis. New York, NY: Praeger.
(2016). The resource utilisation of medically unexplained physical symptoms. SAGE Open Medicine, 4. https://doi.org/10.1177/2050312116666217
(1988). Hypochondriacal traits in medical inpatients. General Hospital Psychiatry, 10, 236 – 244. https://doi.org/10.1016/0163-8343(88)90029-1
(2018).
Prävention und Gesundheitsförderung bei Männern und Frauen . In K. HurrelmannM. RichterT. KlotzS. Stock. (Hrsg.), Referenzwerk Prävention und Gesundheitsförderung (S. 419 – 428). Göttingen: Hogrefe.(2001). Redefining medical students’ disease to reduce morbidity. Medical Education, 35, 724 – 28. https://doi.org/10.1046/j.1365-2923.2001.00958.x
(1994). Therapists as patients: a national survey of psychologists’ experience, problems, and beliefs. Professional Psychology, Research and Practice, 25, 247 – 258. https://doi.org/10.1037/0735-7028.25.3.247
(2017). Long-term outcome of bodily distress syndrome in primary care: A follow-up study on health care costs, work disability, and self-rated health. Psychosomatic Medicine, 79, 345 – 357. https://doi.org/10.1097/psy.0000000000000405
(2006).
Probleme der Lebensqualität von Psychotherapeuten . In: O. F. KernbergB. DulzJ. Eckert (Hrsg.), Wir: Was wir Psychotherapeuten schon immer über uns wissen wollten (S. 92 – 101). Stuttgart: Schattauer.(1996). Transient and persistent hypochondriacal worry in primary care. Psychological Medicine, 26, 575 – 589. https://doi.org/10.1017/S0033291700035650
(2020). Krankheitsängste bei Psychologiestudierenden – Studie zur Angst vor körperlichen Erkrankungen und psychischen Störungen. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 49, 103 – 112. https://doi.org/10.1026/1616-3443/a000578
(1994). Bottlenecks in the diagnosis of hypochondriasis. Comprehensive Psychiatry, 35, 306 – 315. https://doi.org/10.1016/0010-440X(94)90024-8
(1999).
Weiblichkeit – Männlichkeit und psychische Gesundheit . In E. BrählerH. Felder (Hrsg.), Weiblichkeit, Männlichkeit und Gesundheit (S. 31.57). Westdeutscher Verlag, Opladen.(2006).
Medical students’ disease: Health anxiety and worry in medical students . In M. V. Landow (Ed.), Stress and mental health in college students (pp. 29 – 62). New York, NY: Nova Science Publishers.(2004). Does medical school cause health anxiety and worry in medical students? Medical Education, 38, 479 – 81. https://doi.org/10.1046/j.1365-2929.2004.01813.x
(2009). Psychologist Impairment: What is it, how can it be prevented, and what can be done to address it? Clinical Psychology: Science and Practice, 16, 1 – 15. https://doi.org/10.1111/j.1468-2850.2009.01137.x
(2018). Mental health problems among clinical psychologists: Stigma and its impact on disclosure and help-seeking. Journal of Clinical Psychology, 74, 1545 – 1555. https://doi.org/10.1002/jclp.22614
(2014). Medical student syndrome: fact or fiction? A cross-sectional study. Journal of the Royal Society of Medicine, 5, 1 – 9. https://doi.org/10.1177/2042533313512480
(2020). Die schönste Zeit des Lebens? Psychische Belastungen von Studierenden am Beispiel einer deutschen Hochschule. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 49, 43 – 51. https://doi.org/10.1026/1616-3443/a000573
(2010). Screening for hypochondriasis with the Illness Attitude Scales. Journal of personality assessment, 92, 260 – 268. https://doi.org/10.1080/00223891003670216
(2014). Epidemiology of hypochondriasis and health anxiety: Comparison of different diagnostic criteria. Current Psychiatry Reviews, 10, 14 – 23. https://doi.org/10.2174/1573400509666131119004444
(1966). Medical students’ disease: Hypochondriasis in medical education. Journal of Medical Education, 41, 785 – 90.